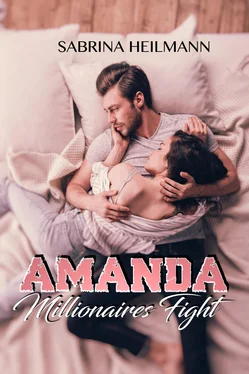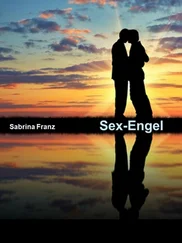Nie im Leben hätte ich gedacht, dass mir das selbst passieren würde.
In der einer Sekunde hatte ich noch mit dem süßesten Typen der ganzen Veranstaltung gesprochen, schon in der nächsten Sekunde hatte man mir alles genommen, was mir wichtig war.
Schluchzend rannte ich durch den Veranstaltungssaal, doch niemand bekam mich wirklich mit. Menschen, die mich noch vor Stunden für mein atemberaubendes Outfit gelobt hatten, sahen nun einfach durch mich hindurch. Und wenn ich ehrlich war, wollte ich auch nicht bemerkt werden. Ich wollte nur noch weg.
Ich stieß die beiden großen Flügeltüren auf und rannte so schnell, wie ich konnte. Der Schmerz tat nicht nur körperlich von dem weh, was mir angetan wurde, nein, er fraß sich direkt in mein Herz und brachte es um. Er brachte mich um.
Ich rannte noch schneller, kniff dabei schluchzend die Augen zusammen und schüttelte leicht den Kopf. Die Bilder der letzten Stunde brannten sich in mein Gedächtnis. Bild für Bild, Gefühl für Gefühl, Schmerz für Schmerz. Ich wollte, dass es aufhörte, dass diese Mischung aus Abscheu, Angst und dem Wunsch, es zu verdrängen, endlich verschwand. Aber das tat es nicht.
Ich stieß eine weitere Tür auf und die kühle Berliner Luft empfing mich. Ich spürte die Kälte kaum, denn in meinem Inneren war bereits alles zu Eis erstarrt.
Beim Rennen hob ich den Rock meines Kleides an und eilte die Treppenstufen nach unten. Ich wollte nach Hause. Ich wollte nur noch unter die Dusche, mir diesen Abend vom Körper waschen und mich in mein warmes, sicheres Bett legen, um zu weinen. Keine Sekunde länger konnte ich an diesem Ort bleiben, ein Ort voller Scheinheiligkeit und Schauspielerei.
Ich achtete nicht auf meine Umgebung, ignorierte den Verkehr und rannte über die Straße. In diesem Moment war mir egal, ob ich sterben würde, denn man hatte mich bereits umgebracht. Vielleicht reagierte ich aus diesem Grund auch nicht mit Angst, als die beiden Lichter des Sportwagens auf mich zugerast kamen und ich das Quietschen der Bremse hörte. Ich blieb wie angewurzelt stehen, hob leicht den Kopf und sah meinem Schicksal entgegen. Das Auto würde nur das beenden, was bereits angefangen worden war. Danach wäre ich frei ... frei von allem. Frei von ihm.
Doch es passierte nichts.
Der Wagen kam kurz vor mir zum Stehen und ein junger Mann stieg aus.
»Hey, was machst du denn?«, fragte er und kam zu mir gelaufen. Er packte mich leicht an der Schulter, doch ich schreckte sofort zurück.
»Lass mich«, flüsterte ich, ohne ihn genauer anzusehen, und wollte weiterlaufen. Doch seine Hand schnellte an mein Handgelenk und drehte mich zu ihm um.
»Amanda, hey, sieh mich an. Was ist los?« Er wollte mich zu sich ziehen, doch ich schob ihn nur weg und blickte auf.
Es war Luca ... der junge Mann, mit dem ich mich kurz unterhalten hatte, bevor mein Leben sich für immer veränderte.
»Nein!«, weinte ich, riss mich von ihm los und rannte.
AMANDA
Zwei Jahre später
Ich fühlte mich furchtbar ... schwach und ausgelaugt. Am liebsten hätte ich den ganzen Tag geschlafen, doch es gab Regeln.
»Amy, ich bin mir sicher, Matt versteht es, wenn du liegen bleiben möchtest.« Abby sank neben mir auf die Matratze, die zwischen Schutt, abgebröckelter Farbe und dem Müll der anderen lag.
»Wir wissen beide, Matt hasst mich. Ich könnte im Sterben liegen, er würde mich losschicken«, brachte ich leise hervor und hustete.
Es war Mitte Oktober und bereits fürchterlich kalt in Berlin. Nachts kamen die Temperaturen dem Gefrierpunkt schon ziemlich nahe. Auch wenn das alte Abbruchhaus in Mitte, das wir vor einigen Monaten gefunden hatten, uns bedeutend mehr Schutz vor dem Wetter bot als ein Platz unter der Brücke, war es dennoch eiskalt. Die beiden dünnen Decken, die ich besaß, hielten mich nur selten wirklich warm.
»Ich kann mit Matt sprechen, wenn du möchtest«, sagte meine beste Freundin und strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie ließ ihre Finger über meine Stirn gleiten und seufzte leise. »Du hast Fieber. Ich werde dich auf keinen Fall mit rausnehmen.«
»Das hast du nicht zu bestimmten, Abby«, donnerte Matt plötzlich und kam auf uns zu. »Steh auf!«
Abby tat sofort, was er sagte, und trat zur Seite, während ich mich vorsichtig aufrichtete. Alles drehte sich, mir war warm und kalt zugleich und mein Kopf drohte zu explodieren. Matt, der sich zunächst bedrohlich vor mir aufbaute, beugte sich plötzlich zu mir und zog mich grob am Arm nach oben. Er gehörte zu den Menschen, der nichts auf die Gefühle anderer gab. Schon als ich ihn kennengelernt hatte, waren seine Augen tot gewesen. Die einzige Nuance, die man gelegentlich in ihnen erkannte, war Unberechenbarkeit ... vor allem, wenn er wieder etwas genommen hatte.
»Matt, du tust mir weh«, stöhnte ich auf, doch das interessierte ihn nicht. Das tat es nie.
Matt war mindestens drei Köpfe größer als ich und bedeutend stärker. Er trainierte regelmäßig mit den anderen Jungs, unter dem Vorwand, dass sie uns beschützen könnten, sollte es einmal ungemütlich werden. Er war so etwas wie der Anführer unserer kleinen Gruppe, was kein Wunder war, schließlich lebte er bereits auf der Straße, seit er mit dreizehn Jahren von zu Hause weggelaufen war. Das war nun zwölf Jahre her. Er machte uns immer wieder klar, dass er die meiste Erfahrung hatte und dass wir einfach nur zu gehorchen hätten.
Matt und ich waren schon kurz nach unserem Kennenlernen aneinandergeraten. Ich war nie ein Mensch gewesen, der den Mund hielt, wenn ihm etwas nicht passte. Zumindest früher nicht. Heute sah das ein bisschen anders aus. Ich legte mich nicht mehr mit Matt an. Nicht, weil ich sein Verhalten plötzlich tolerierte, sondern weil ich nur die Tage hinter mich bringen wollte. Das Leben auf der Straße hatte an meinen Nerven gezerrt und ich hatte einfach keine Kraft mehr, mich gegen alles und jeden aufzulehnen.
Wie bereits erwähnt, es gab Regeln – Matts Regeln – und ich akzeptierte sie, weil ich es einfach musste.
»Also Prinzessin Amanda, welches Wehwehchen haben wir, dass wir unsere Aufgabe heute nicht erfüllen wollen?«, spottete Matt und schob mich an die Wand, seine Hand fest um meinen Arm gelegt.
»Keins, Matt, überhaupt keins«, erwiderte ich leise und verzog mein Gesicht vor Schmerz, da er seinen Griff verstärkte.
»Matt, ich werde sie nicht mitnehmen«, schaltete sich nun Abby ein. Sie und Matt kannten sich länger und verstanden sich auch besser. Manchmal kam es sogar vor, dass er auf sie hörte. »Sie ist erkältet und mir absolut keine Hilfe.«
»Erkältet also«, grummelte er und sah von mir zu Abby und wieder zu mir. Mit der freien Hand umschloss Matt mein Gesicht und drückte meinen Kiefer zusammen. Er zwang mich, ihn anzusehen. Der Blick in seine Augen verriet mir, dass er erst vor Kurzem etwas genommen haben musste. Drogen und Alkohol waren eine sichere Zuflucht für Straßenkinder. Auch ich hatte mich anfangs oft betrunken, genauso wie ich das Zeug probiert hatte, dass die anderen so nahmen.
Es machte mich kaputt, das hatte ich schnell bemerkt und doch ... manchmal blieb es einfach die Garantie für einen guten Tag.
»Matt, komm schon. Ich kann allein Kohle und Essen besorgen. Amy soll sich ausruhen.« Abbys Stimme nahm einen panischen Unterton an, der mir nicht entging, Matt aber sehr wohl. Er war wieder in dieser Phase, in der man nicht wusste, was die Drogen als Nächstes mit ihm anstellten.
»Einen Scheiß wirst du, Abby. Seit diese Göre hier aufgetaucht ist, macht sie nur Probleme«, schrie Matt, löste seine Hand von meinem Arm und schlug gegen die Wand neben meinem Kopf. Ich zuckte instinktiv zusammen, doch das ermutigte ihn nur, den Druck auf meinen Kiefer zu erhöhen. »Verpiss dich, Amy, und krepier an deiner Scheißerkältung!«
Читать дальше