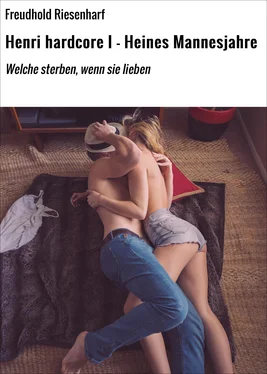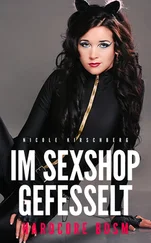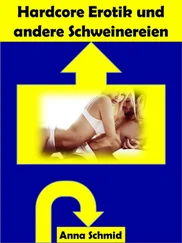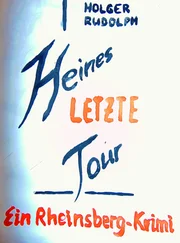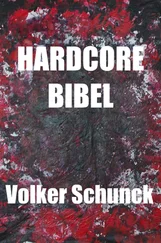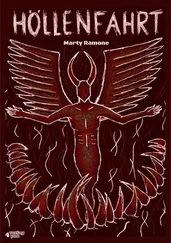Es sei ein eigener Umstand, dass die Fichtesche Philosophie immer viel von der Satire ausstehen musste. Mal sieht er eine Karikatur, die eine Fichtesche Gans vorstellt. Sie hat eine so große Leber, dass sie nicht mehr weiß, ob sie die Gans ist oder die Leber. Auf ihrem Bauch steht: Ich = Ich. Jean Paul habe die Fichtesche Philosophie in einem Buch betitelt Clavis Fichteana aufs heilloseste persifliert. Dass der Idealismus in seiner konsequenten Durchführung am Ende sogar die Realität der Dinge selbst leugne, das erschien dem großen Publikum als ein Spaß, der zu weit getrieben. Wir mokierten uns nicht übel über das Fichtesche Ich, welches die ganze Erscheinungswelt durch sein bloßes Denken produzierte. Unseren Spöttern kam dabei ein Missverständnis zustatten, das zu populär geworden, als dass ich es unerwähnt lassen dürfte. Der große Haufe hat nämlich gemeint, das Fichtesche Ich, das sei das Ich von Johann Gottlieb Fichte, und dieses individuelle Ich leugne alle anderen Existenzen. „Welche Unverschämtheit!“, riefen die guten Leute, „dieser Mensch glaubt nicht, dass wir existieren, wir, die wir weit korpulenter als er und als Bürgermeister und Amtsaktuare sogar seine Vorgesetzten sind!“ Die Damen fragten: „Glaubt er nicht wenigstens an die Existenz seiner Frau? Nein? Und das lässt Madame Fichte so hingehn?“ –
So groß scheint das Missverständnis der einfachen Leute aber auch wieder nicht. Denn leugnet der Idealismus in äußerster Konsequenz die Realität der Materie, dann muss der Idealist auch die Existenz der anderen Menschen leugnen, die ja aus Materie sind; übrig bleibt nur sein eigenes solipsistisches Ich, und auch Frau Fichte muss es sich gefallen lassen, tatsächlich nur in Fichtes Gedanken zu existieren. Entweder also, man akzeptiert die Existenz einer objektiv seienden, bewusstseinsunabhängigen Welt, dann ist man sofort beim Realismus und sieht in der Erkenntnis eine ideelle Rekonstruktion des objektiv Seienden mit den Mitteln des erkennenden Subjekts. Dann ist auch das erkennende Subjekt selbst Materie, und der Geist deren Funktion! Oder aber man verkennt die objektive Welt, dann landet man am Ende beim Solipsismus.
Da hilft es auch nichts, zu meinen: Das Fichtesche Ich ist aber kein individuelles Ich, sondern das zum Bewusstsein gekommene allgemeine Welt-Ich. Das Fichtesche Denken ist nicht das Denken eines Individuums, eines bestimmten Menschen, der Johann Gottlieb Fichte heißt; es ist vielmehr ein allgemeines Denken, das sich in einem Individuum manifestiert. So wie man sagt: es regnet, es blitzt usw., so sollte auch Fichte nicht sagen: „Ich denke“, sondern: „Es denkt“, „das allgemeine Weltdenken denkt in mir“.
Das ist aber keine Lösung. Wie nämlich kommt dieses allgemeine Weltdenken in meinen Kopf? Aus einer immateriellen, von der materiellen Ebene unabhängigen Dimension des Geistes? Sicherlich nicht, eine solche Dimension gibt es überhaupt nicht. Mein Denken ist allein und ausschließlich eine Funktion meines Gehirns, also eines materiell-energetischen Organs. Warum sollten wir das zu einem ,allgemeinen Weltdenken' verbrämen? Auch Fichtes Denken ist nur eine Funktion von Fichtes Hirn, und das ,allgemeine Weltdenken' höchstens das gesamte Denken aller einzelnen Gehirne der Welt.
Dies aber: dass aller Geist in der Welt nur der menschliche Geist ist, und der menschliche Geist identisch mit der Funktion des menschlichen Hirns – Geist also eine Funktion der Materie, und sonst nichts –, – dies ist der wissenschaftliche Realismus der Moderne, und als solcher Heine noch genauso wenig geheuer wie manch anderen seiner Zeitgenossen. Er selbst wird sich nicht schlüssig und fühlt sich widerwärtig berührt von den grellen Worten, womit Fichte unseren Gott für ein bloßes Hirngepinst erklärt und sogar ironisiert. Der Fichtesche Idealismus sei gottloser und verdammlicher als der plumpeste Materialismus. Was man in Frankreich den Atheismus der Materialisten nenne, wäre noch immer etwas Erbauliches, etwas Frommgläubiges, in Vergleichung mit den Resultaten des Fichteschen Transzendentalidealismus: Soviel weiß ich, beide sind mir zuwider. Beide Ansichten sind auch antipoetisch. Die französischen Materialisten haben ebenso schlechte Verse gemacht wie die deutschen Transzendentalidealisten .
Apropos ,plumpester Materialismus'. Dass er den Materialismus nicht anders denn plump sehen kann, beweist nur, dass er ihn nicht versteht. Er unterschätzt, was beim damaligen Stand der Physik allerdings auch nicht erstaunlich ist, bei weitem die Möglichkeiten der Materie – insonders der des Gehirns. Insbesondere scheint er der Ansicht, das Gehirn sei nicht dazu fähig, das menschliche Bewusstsein hervorzubringen. Er überschätzt also das Bewusstsein und unterschätzt das Gehirn.
Als Nächstes kommt er auf Fichtes Schüler Schelling. Ebenso wie Herr Joseph Schelling lehrte auch Fichte: Es gibt nur ein Wesen, das Ich, das Absolute; er lehrte Identität des Idealen und des Realen. In der Wissenschaftslehre hat Fichte durch intellektuelle Konstruktion aus dem Idealen das Reale konstruieren wollen. Herr Joseph Schelling aber dreht die Sache um: er sucht aus dem Realen das Ideale herauszudeuten. Von dem Grundsatz ausgehend, dass der Gedanke und die Natur ein und dasselbe seien, gelangt Fichte durch Geistesoperation zur Erscheinungswelt, aus dem Gedanken schafft er die Natur, aus dem Idealen das Reale; dem Herrn Schelling hingegen, während er von demselben Grundsatz ausgeht, werde die Erscheinungswelt zu lauter Ideen, die Natur wird ihm zum Gedanken, das Reale zum Idealen. Beide Richtungen, die von Fichte und die von Schelling, ergänzten sich daher gewissermaßen. Denn nach jenem erwähnten obersten Grundsatz konnte die Philosophie in zwei Teile zerfallen, und in dem einen Teil würde man zeigen: wie aus der Idee die Natur zur Erscheinung kommt; in dem andern Teil würde man zeigen: wie die Natur sich in lauter Ideen auflöst. Die Philosophie konnte daher zerfallen in transzendentalen Idealismus und in Naturphilosophie. Diese beiden Richtungen habe Schelling auch wirklich anerkannt, und die letztere verfolgte er in seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur , und erstere in seinem System des transzendentalen Idealismus .
Indessen, beide Grundsätze sind einer so verfehlt wie der andere, und auch Schelling gewinnt keinen Blumentopf. Philosophisch komme Schelling nicht weiter als Spinoza: Aber Herr Schelling verlässt jetzt den philosophischen Weg und sucht durch eine Art mystischer Intuition zur Anschauung des Absoluten selbst zu gelangen, er sucht es anzuschauen in seinem Mittelpunkt, in seiner Wesenheit, wo es weder etwas Ideales ist noch etwas Reales, weder Gedanken noch Ausdehnung, weder Subjekt noch Objekt, weder Geist noch Materie, sondern … was weiß ich! Hier hört die Philosophie auf bei Herrn Schelling, und die Poesie, ich will sagen, die Narrheit, beginnt . Hier aber auch findet er den meisten Anklang bei einer Menge von Faselhänsen, denen es eben recht ist, das ruhige Denken aufzugeben und gleichsam jene Derwisch Tourneurs nachzuahmen, die, wie unser Freund Jules David erzählt, sich so lange im Kreise herumdrehen, bis sowohl objektive wie subjektive Welt ihnen entschwindet, bis beides zusammenfließt in ein weißes Nichts, das weder real noch ideal ist, bis sie etwas sehen, was nicht sichtbar, hören, was nicht hörbar, bis sie Farben hören und Töne sehen, bis sich das Absolute ihnen veranschaulicht.
Schauplatz dieser tanzenden Derwische sei das bayerische München, eine Stadt, welche ihren pfäffischen Charakter schon im Namen trägt und auf Latein Monacho monachorum heißt … –
Grund für den Niedergang Schellings sei das Auftreten eines größeren Denkers, der die Naturphilosophie zu einem vollendeten System ausbildet, aus ihrer Synthese die ganze Welt der Erscheinungen erklärt, die großen Ideen seiner Vorgänger durch größere Ideen ergänzt, sie durch alle Disziplinen durchführt und also wissenschaftlich begründet. Er ist ein Schüler des Herrn Schelling, aber ein Schüler, der allmählich im Reiche der Philosophie aller Macht seines Meisters sich bemeisterte, diesem herrschsüchtig über den Kopf wuchs und ihn endlich in die Dunkelheit verstieß.
Читать дальше