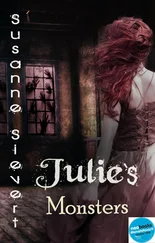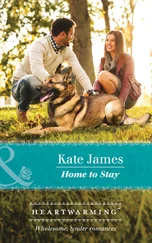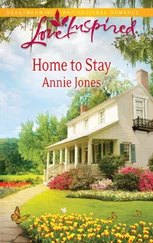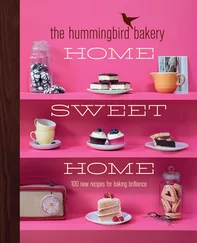Er war ein netter, junger Mann mit tiefbraunen Augen und einem Lächeln, das ihn sehr interessant machte. Aus einer Laune heraus fasste ich den Entschluss, etwas zu riskieren. Warum auch nicht? Es gab womöglich Menschen, die der Mühe wert waren. Ich unterhielt mich mit ihm, erzählte ihm ein wenig von mir, aber am Ende blieb es immer nur bei einem höflichen „Hallo“ und „Schönen Feierabend“.
Mein Körper strahlt stets eine Warnung an alle Mitmenschen aus. Er sagt ihnen in roten Buchstaben: „Nicht anfassen! Verpiss dich!“
Bei Judith ist es anders. Sie pfeift auf alle Warnungen und durchdringt meine Schutzmauer, die ich jahrzehntelang vor mir her geschoben habe und von der ich selbst nicht wusste, ob ich sie je würde verlassen können.
Wir haben uns vor fünf Tagen vor der Bar gesehen und wussten sofort, dass unsere Leben auf merkwürdigste Weise miteinander verstrickt sind. Ich habe immer gehofft, dass ich mal jemanden finden würde, mit dem ich zusammensein will . Dass das nun eine Frau ist – nun gut, ich will mich in Angesicht des Weltuntergangs nicht beschweren. Ich fühle mich bei ihr wohl und das ist alles, was wichtig ist.
„Ich brauche eine Zigarette und einen Kaffee“, sagt sie trocken und blinzelt auf mein Dekolleté. Ihre braunen Augen werden von dichten schwarzen Wimpern umrahmt und betonen ihr schönes, weiches Gesicht und ihre vollen roten Lippen. Ihren runden Kopf trägt sie kahlrasiert und auf ihrem Hinterkopf schlängelt sich eine grüne Schlange ihren Nacken hinab. Judith ist ein Mensch, der das Leben so nimmt, wie es ist, und das gefällt mir.
Seufzend und mit rollenden Augen ziehe ich aus meinem Büstenhalter meine letzten beiden Zigaretten hervor und reiche ihr eine davon.
„Mit Kaffee kann ich nicht dienen, Lady Lockenlicht“, antworte ich grinsend und sehne mich selbst nach einer heißen Tasse.
„Wenn die herausfinden, dass wir hier oben entspannt eine Zigarette rauchen, sind wir so gut wie tot.“
Das sind wir ohnehin, denke ich, aber ich spreche es nicht aus.
Judith holt aus ihrer Weste ein Zippofeuerzeug und zündet erst mir, dann sich selbst die Zigarette an. Ich zucke gleichgültig mit den nackten Schultern und gönne mir demonstrativ einen langen Zug.
Mit die meint Judith unsere Gesellschaft im Verkaufsraum. Auf unserer Flucht haben wir noch drei weitere Menschen eingesammelt, die sich nun schon seit fünf Tagen heulend, schreiend und streitend unter uns befinden. Das ist der Grund, warum ich die meiste Zeit auf dem Dach sitze und die Zombies bei ihrem Treiben beobachte. Ja, die lebenden Toten sind das nackte Grauen – keine Frage – aber die Lebenden sind der Grund, warum ich mir Sorgen mache. Sie reden zu viel, sind rücksichtslos und stehen sich selbst am nächsten.
Unter Menschen fühle ich mich wie in einem vollen Bus, in dem mir unangenehme Gerüche entgegenschlagen und unabsichtliche Berührungen mich quälen. Die Alten stehen und schaukeln in jeder Kurve verdächtig hin und her. Die jungen Leute sitzen hingegen auf ihrem Arsch, vergraben ihre Gesichter hinter Smartphones und lesen Nachrichten, die kein Schwein interessieren. Ganz nah aneinander gequetscht, geben sie mir das Gefühl, dass ich ihnen den Lebensraum raube. Körperkontakt ist einfach ein Albtraum!
Ihre Stimmen machen mich wahnsinnig und hier auf dem Dach finde ich Gelegenheit, um nachzudenken.
Als hätte Judith meine Gedanken erraten, fragt sie: „Du hast einen Plan, nicht wahr? Früher oder später müssen wir aus unserer Deckung raus. Die Vorräte von deinem Boss sind fast aufgebraucht. Irgendetwas müssen wir uns einfallen lassen.“
Die Vorräte von Mr. Jefferson bestehen aus Schokolade, Chips und Cola, die wir in seinem Büro gefunden haben. Außerdem noch Kekse, ein alter, trockener Kuchen von seiner letzten Geburtstagsfeier und Trockenfleisch, das er zu jeder Gelegenheit wie Tabak kaute. Das Zeug stinkt erbärmlich und schmeckt genauso grausig, aber es stillt den Hunger. Alle haben den gleichen Anteil erhalten. Möglicherweise können wir noch drei oder vier Tage ausharren, aber was passiert dann?
„Wir müssen weg von hier.“ Bedächtig ruht ihre Hand auf meinem Unterarm. Jeden anderen hätte ich zum Teufel gejagt, aber nicht Judith. Sie ist so ehrlich zu mir, wie ich es verdiene.
„Was veranlasst dich, zu glauben, dass ich einen Plan hätte? Unter uns bin ich die Einzige, die im Leben noch nie einen Plan gehabt hat.“
„Schätzchen, ich sehe doch, wie es hinter deiner Stirn arbeitet.“ Mit ihrem schwarz lackierten Nagel tippt Judith sich gegen die eigene Stirn und bläst den Zigarettenrauch aus. „Du hast einen Plan. Seit fünf Tagen finde ich dich hier auf dem Dach, während du in aller Ruhe den Toten beim Fressen zuschaust. Wer solch eine Ruhe besitzt, hat im Leben schon Schlimmeres ertragen. Schau mich nicht mit so großen Augen an. Glaubst du, in meiner Zeit als Barkeeperin habe ich gar nichts über Menschen gelernt? Du sagst, du hast keinen Plan? Dass ich nicht lache. Du hattest bereits einen, als wir vor fünf Tagen schreiend aus der Bar gerannt sind. Menschen wie du haben immer einen Einfall, denn wie sollen sie sonst mit ihren Dämonen leben?“
Menschen wie ich ... Was zum Teufel redet sie für einen Unsinn? Es stimmt, ein paar Abschnitte in meinem Leben waren der Horror, aber machen mich die Erfahrungen jetzt zu einer wandelnden Toten? Zu einer von denen dort unten?
„Ich kann Cherryhill nicht ausstehen“, antworte ich und mit Judiths Lachen verraucht meine Wut auf ihre Ehrlichkeit. Jedes Wort von ihr trifft mich wie eine heiße Nadel und ich streiche unbewusst über meine Arme, auf denen meine Mutter ihre Spuren hinterlassen hat.
„Erzähl mir, wie du den Weg nach Cherryhill gefunden hast.“
„Das habe ich dir doch schon erzählt.“
Auf einmal fühle ich mich sehr unwohl, was in Anbetracht der Geschehnisse kein Wunder ist. Ich rutsche ein Stück von Judith weg, ihre Nähe fühlt sich nicht länger gut an. Meine Kehle schnürt sich zu und als Judith ihren Arm um mich legt und „Nun komm schon“ sagt, sehe ich nur, wie sich ihre roten Lippen öffnen und schließen.
Judith bemerkt meine Starre und weicht zurück. Sie sagt kein Wort. In ihren Augen kann ich es sehen: Sie versteht mich und das bringt mich wieder ein Stück näher zu ihr.
„Dafür haben wir keine Zeit.“ Meine Ausrede klingt hohl.
„Schätzchen, ich weiß ja nicht, ob es an dir vorübergegangen ist, aber die Zeit, wie wir sie kennen, ist abgelaufen.“
Es beginnt. Home, sweet home.
Vor 5 Tagen
Das Taxi hält mit stockender Bremse in einer riesigen Staubwolke an. Meilenweit befindet sich kein Nachbarhaus, und trotzdem wäre der Trottel direkt an dem weißen Haus mit der kunstvoll geschnitzten Veranda vorbeigefahren, hätte ich ihn nicht mit trockener Kehle daran erinnert. Mein Herz schlägt schneller, als sich der Staub legt und ich einen freien Blick aus dem Fenster erhalte.
Mein Gott, was mache ich hier nur? Ich muss verrückt geworden sein, zurückzukommen...
Mit einem Räuspern erinnert mich der Taxifahrer nun daran, zu zahlen. Ich greife langsam nach meinem Rucksack und noch langsamer nach meiner Geldbörse, als könnte ich es so verhindern, aus dem Auto steigen zu müssen. Ungeduldig klickt er mit einem Kugelschreiber und als Dank erhalte ich nur ein unverständliches Brummen. Er hilft mir nicht beim Gepäck und als ich gerade ein Bein aus dem Auto setze, startet er den Motor und rollt voran.
Das alles stört mich nicht. Ich bekomme es nur am Rande mit, denn das weiße Haus mit dem grünen Garten und dem See dahinter hält mich völlig in seinem Bann. Ich starre von Weitem durch das große Fenster im Erdgeschoss und erwarte eine Bewegung an der Gardine, eine Hand am Fenster oder ein Gesicht, das heimlich hinter dem Glas hinausschauen möchte. Doch es herrscht Ruhe.
Читать дальше