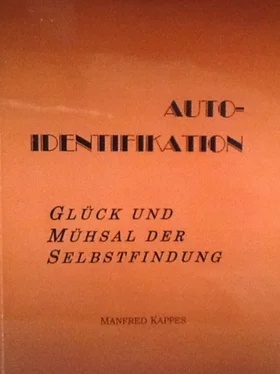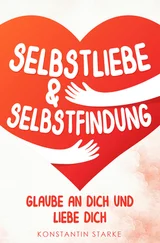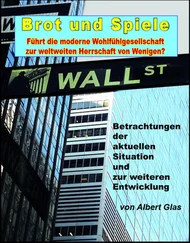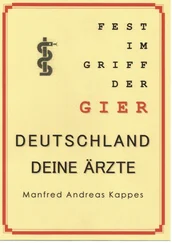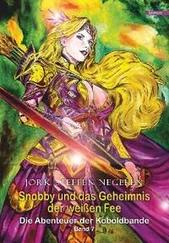Manfred Kappes - Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Kappes - Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die in der Frühzeit des Menschseins unerklärbaren Urwelterscheinungen wurden alsbald mit außerirdischen, das heißt nicht belegbaren materiellen Menetekeln, mit mystischen Quellen in Verbindung gebracht. –
Als erfassbares und bekanntes Exempel könnte dienen, dass bei den Germanen der beängstigende Donnerbegriff dem Gott Donar – Thor – beigeordnet wurde. Als Sprachfamilie fand man diese Gottheit, die das Mirakel der verderbend drohenden Phänomene veranschaulichte. Er war der bedeutsamste germanische Gott aus dem Geschlecht der Asen. (s. Edward Grieg (1843-1907) ›Der Tod der Ase‹ )
Neue Gottheiten wurden nach fortschreitender Glaubensverbreitung legitim und zur Überzeugungskraft den Heiden gegenüber erforderlich. Sie standen jedoch bei der Christianisierung durch angelsächsische Missionare – z. B. Bonifazius (672-754), Switbert (bis-712) und andere mehr – im 6./7. Jahrhundert dem Glauben des christlichen Monotheismus zuwider. Aber musste für die Urbewohner ein Zugeständnis gemacht werden? Ist dies die Urform und Entstehungsgeschichte der Heiligen in der christlichen Kirche?
Mythos versus Denken um das ›ich‹
Mythos versus Denken um das ›ich‹ ist eine besonders schwierige Methode, um die Denkstrukturen des ›ich‹ zu erfassen, zumal es um ihre ureigenste Deutung geht. – Denken… denken kann ein jeder, aber denken ist, wenn das Resultat einer solch beschwerlichen Sisyphusarbeit unwiderlegbar, gleichermaßen eine logische Folgerung sein soll. Und bisweilen, je nach Schwierigkeitsgrad der Klärung, eine ungleich belastende Arbeit. – Und wer möchte in eigener Person despotisch zur Ergründung eines noch unbekannten Nichts arbeiten, sei hier ergänzend streng hypothetisch nachgefragt?
Und überdies: Viele Menschen glauben, dass Denken und Schlussfolgern im Wesentlichen dasselbe sind. Eine heikle Überforderung seiner selbst, von seinem ›ich‹ ? Soll die Konsequenz daraus sein, dass die Art der freien Assoziation ein wesentlicher Teil menschlichen Überlegens überhaupt darstellt? Schaut das ›ich‹ den eigenen Gedanken wie einem fließenden Gewässer zu? – Kann das Nachdenken über das menschliche Denken zu einem strikten Resultat führen, oder bleiben diese Gedanken des ›ich‹ , über das ›ich‹, auf unfertiger Wegstrecke einem baldigen und leider unbehaglichen Ende überlassen?
Anderseits hat es den Anschein, jemandem das Folgern beizubringen, sei unbestreitbar eine schwere Aufgabe. Wie soll man es gleichsam anfangen, einen Menschen, dem die ständige Arbeit, die Sorge um den Arbeitsplatz und die Auswahl des täglichen TV-Programms genug Leistung der Gehirnzellen abverlangt, außerdem noch dazu bewegen, über seinen Tellerrand zu blicken, hinaus in unbekanntes Terrain zu sinnen? Man muss selbstbewusst sein, um einen anderen Menschen derart zu beeinflussen, dass er sich dieser gedanklichen Mühen unterzieht.
Es gibt in der Tat eine dokumentarische Erläuterung dafür, in der uns der französische Maler-Philosoph Gustav Courbet (1819-1877) unterweist. Er bezieht sich augenscheinlich nicht stark auf seine eigenen philosophischen Denkweisen, vielmehr die der Psychologie, wenn er behauptet:
»Ich kann selbst Steine zum Reden bringen!«
Gerne wären wir darüber informiert, wie der Romantiker Courbet sich sein Innenleben vorstellt, wie er seinem eigenen ›ich‹ gegenüber argumentiert und Stellung bezieht. Anstatt eine förderliche Antwort zu erhalten, legt er sogleich wieder sein Aufsehen erregendes Maltalent in die Waagschale. Vergeblich haben wir sein ›ich‹- Menetekel erwartet.
Um logisch zu begreifen, das ist aber Vorausbedingung der Erkundigung, müssen wir uns konzentriert über die Zwischenstationen auf dem widerspenstigen Weg im Unverkennbaren klar sein. Nicht nachlassen im Erkennen des Kontinuums als kognitives Spektrum an Gedankenstilen ist die Grundtatsache des menschlichen Denkens. – Man sollte nicht sagen,
» … ich denke, sondern ich werde gedacht «.
So sieht es jedenfalls Arthur Rimbaud (1854-1891). Diese Sehweise kann in Zweifel gezogen werden, wenn sie als These im Focus von Descartes belichtet wird.
Wie reüssiert zu diesen Sinndeutungen ein bekannter heutiger Schriftsteller dieses possessive Bild? Wir lassen ihn zu Wort kommen:
»In diesem Moment begriff er, dass niemand seinen eigenen Verstand benutzen wollte. Menschen wollen Ruhe. Sie wollen essen und schlafen, und sie wollen, dass man nett zu ihnen ist. Denken wollen Sie nicht.«
Trifft diese Sequenz auf den an wichtigen Themen uninteressierten TV-Schläfer zu, Herrn Jedermann also? –
Eine wissenschaftliche Charakteristik von Denkvorgängen hat der Hirnforscher Roth als Wissenschaftler der Universität Bremen erarbeitet:
» Unser Gehirn scheut das Denken, weil es eine wahnsinnig Energie raubende Tätigkeit ist. Wer nachdenke, dessen Großhirnrinde verbrauche ungeheuer viel Zucker und Sauerstoff. Deshalb versucht es, möglichst wenig nachzudenken und alles Mögliche zu automatisieren. – Herrsche Zeitdruck, werde Noradrenalin ausgeschüttet; dieses Hormon aktiviert die Muskeltätigkeit, erhöht die Wachsamkeit und sorgt dafür, dass das Denken ausgeschaltet wird.«
Ebenso problematisch sei es für unser Hirn, wenn es mit ständig neuen Reizen konfrontiert werde, da wir nicht mehr als einen Gedanken gleichzeitig nachgehen können. – Vielleicht erklärt die Forschung das Verhalten mancher Menschen?
Unten sehen wir zum Titel diverse Indizien, sie verweisen auf weltbekannte Philosophen, die sich mit mystischem Fabulieren versus Denken und mit dem belassenen annehmbaren Geheimnis ›ich‹ auseinandersetzen.
Zur geschichtlichen Illustration der bedachten Fragestellung nach der persönlichen Existenz des Individuums scheint es erforderlich hinzuweisen, dass das Umhertasten nach Mystischem und Magischem der Realität nahe kommt. Uns interessieren hauptsächlich engagierte Protagonisten in Denkdisziplinen, die nach Abkunft, Sinn und Zweck des eigentlichen Daseins zu charakterisieren sind. Denn eine Replik auf die philosophische Devise ›ich‹ würde wuchernden Zwiespalt sich selbst und außerdem an einem religiösen Angebot inhibieren.
Gedankenarbeit kann von philosophischer Urkraft sein. Kann, muss es trotzdem nicht. Manch einer denkt, er sei ein Philosoph, kann sein, muss aber nicht. Eher: nicht. Beharrlich trägt uns daher das Seminar der Philosophie mit dem Titel › wer bin ich?‹ in die ungefähre Sphäre ernst zunehmender Gedanklichkeit, wir müssen uns ein wenig geduldig zeigen.
Urängste beherrschen das ›ich‹
Anläßlich einer Diagnose des Innersten im Menschen, um zu erkennen, › wer bin ich?‹ könnte es erfolgversprechend sein, die Urängste im Mittelpunkt seiner Reflexionen zu betrachten. – Urängste sind Urgefühle misslicher Art?
Eine vorzugebende These geht davon aus, dass ein Geheimbund die Basis der Ängste begründet, ein Bündnis esoterischer Mächte? Wie ist dies zu erkennen? Ist die Bangigkeit hervorgerufen durch den Schwanengesang nach dem Glauben des Altertums – von Aischylos (525-456 v. Chr.) und Cicero (106-43 v. Chr.) kreiert – das hohe Lied vom baldigen Ende der Menschheit? Pünktlich vor der Theorie des Weltunterganges? – Der Schwanengesang belegt den Mythos obiger Aktuare der Antike, wonach die Singschwäne vor dem Sterben zum letzten Male ein traurig Lied anstimmen.
So gesehen ist die Angst des ›ich‹ beileibe keine Schöpfung unserer Tage. Die Urängste sind demnach archaischen Keimes? Die Bibel ist gerade einmal sieben Kapitel alt, fristgerecht schickt der Herr die Sintflut. Dieses Schreckensszenario kam aus der Tiefe der Zeiten und andauernd wieder verinnerlichte der Mensch diese Botschaft. Ist das ›ich‹ seit Urzeiten mit dem diesem grausigen Angsttrauma belastet?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.