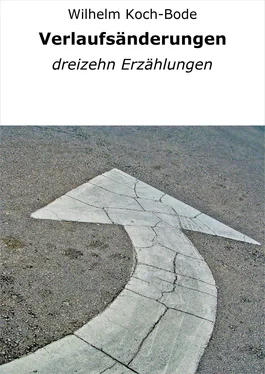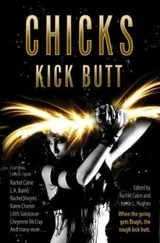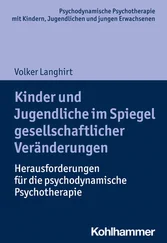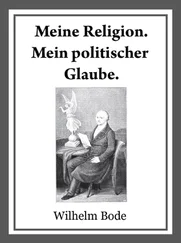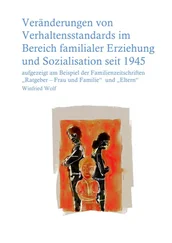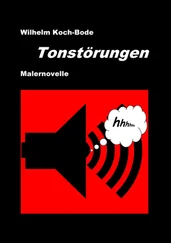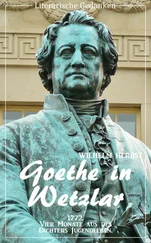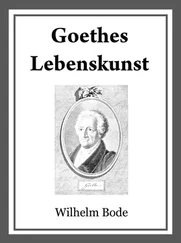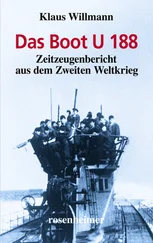Die beiden Männer an seiner Seite, Brüder seiner Frau, wirkten gereizt und ungeduldig in dem Bemühen, ihn, während sie ihn vorwärts schleiften, so zu halten, dass er nicht aus eigener Kraft gehen musste. Seine Füße schwebten in der Luft, berührten nur alle paar Meter den Boden und hinterließen Spuren im trockenen Sand des Gehweges, denen alle nachfolgenden Gäste des Trauerzuges sorgfältig auswichen. Es schien, als hätte sich spontan eine stille Übereinkunft darüber gebildet, diese flüchtigen Zeichen seines Daseins zu erhalten, - wohl ein verlegenes Zeichen kollektiver Achtung der Trauernden vor dem sterbenskranken Hinterbliebenen, der sich durch niemanden davon abhalten lassen hatte, an der Beerdigung seiner Frau teilzunehmen und sie aufrecht bis ans offene Grab zu begleiten. Er hatte eine lebensbedrohlich entzündete Leber, war völlig geschwächt und lag eigentlich auf der Intensivstation des Zentralhospitals. Mit Schrecken hatten Freunde und Klinikpersonal dem Stöhnen, das aus eingesunkener Hülle kam, entnommen, dass er aufstehen und zum Trauerakt gebracht werden wolle. Zunächst widerstrebend, schließlich aber doch in resignativer Anerkennung eines Bedürfnisses, das für den jungen Mann unzweifelhaft von so grundlegender existenzieller Bedeutung war, dass alle Bedenken dahinter verblassten, hatte der Chefarzt dem gewagten Unterfangen zwar nicht zugestimmt, die Krankenbeförderung zum Friedhof aber letztlich stillschweigend geschehen lassen.
Hilal stammt aus Marokko. Karoline hatte am Strand von Agadir, wo sie - mit üppiger Oberweite, prallem Gesäß, strammen Beinen, sehr weißer Haut und blondiertem, strohigem Kurzhaarschnitt - zweifellos Aufsehen erregt hatte, in ihm den Mann ihres Lebens erkannt, ihn zur Übersiedelung in ihre norddeutsche Heimatstadt bewegt und geheiratet. Die beiden waren ein ungleiches Paar. Hilal: hochgewachsen, schlank, muskulös, scharf konturierte ebenmäßige Gesichtszüge, freundliche dunkle Augen, volles lockiges Haar, hellbraune samtene Haut, tiefe klangvolle Stimme. Zwar ist unklar, was er in Marokko gelernt und gearbeitet hat - es heißt, er habe an der Universität von Rabat irgendetwas Technisches studiert -, aber Hilal scheint gebildet zu sein, ist wissbegierig und kommunikativ, in Gesprächen einfühlsam und im Umgang sehr höflich. Eifrig hat er in kurzer Zeit Deutsch gelernt. Karoline: mittelgroß, trotz gedrungener Figur nicht dickleibig, sondern kraftvoll und wendig - wohl ein Ergebnis ihrer langen Karriere als Leistungssportlerin, später Vereinstrainerin im Handball. Sie hatte ein kantiges Gesicht, blassblaue Augen, eine - nach einem Bruch im Turnier - leicht eingedrückte und schief stehende Nase, einen breiten Mund mit aufgeworfenen Lippen über einer langgezogenen, nach unten in einer vorgewölbten Spitze auslaufenden Kinnpartie. Die in neununddreißig Jahren eingespurten Züge in Karolines Antlitz und die in ihr Körperbild eingeschliffenen Bewegungsmuster ließen bei ihr leicht auf unangenehme Wesenszüge - hart, dominant, aggressiv, unsensibel, geltungsbedürftig zum Beispiel - schließen. Das mochte zwar in dem einen oder anderen Punkt zutreffen, aber sie konnte auch andere Seiten zeigen, für die sie weithin Anerkennung fand: kumpelhafte Freundin, kämpferische Sportlerin, energische Trainerin, durchsetzungsstarke Lehrerin, unternehmungslustiger Typ, großzügige Gastgeberin, einfallsreiche Gespielin, gewerkschaftlich engagierte Kollegin - die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen.
Hilal hatte in Deutschland noch keine feste Arbeit. Handwerklich war er recht geschickt, kannte sich mit Autos und Motorrädern aus, reparierte Gebrauchtfahrzeuge, verkaufte diese wieder und machte dabei wohl den einen oder anderen Gewinn. Die beiden lebten hauptsächlich von Karolines Gehalt als Oberstudienrätin an einer Berufsschule, wo sie Sport und Dinge, die irgendwie mit Ernährung und Hauswirtschaft zu tun hatten, unterrichtete. Ihre Familie - der verwitwete Vater und die Brüder mit ihren Ehefrauen - war über diese Partnerwahl verstimmt und lehnte Hilal schroff ab. In Karolines großem Bekanntenkreis wurde er dagegen mit offenen Armen aufgenommen. Mit seinem trockenen Humor, seiner ansteckenden Begeisterungsfähigkeit, seiner warmherzigen, mitfühlenden Aufgeschlossenheit für die Belange anderer, seiner verlässlichen Hilfsbereitschaft bei organisatorischen und technischen Problemen, die zunehmend an ihn herangetragen wurden, hatte er sich bald sehr beliebt gemacht. In der Beziehung zu Karoline legte er - entgegen den Befürchtungen einiger Bekannter - keinerlei herrisches, selbstverliebtes oder ichbezogenes Gebaren an den Tag, sondern zeigte sich voller Fürsorge und füllte die Rolle des emsigen Hausgeistes mit lockerer Hand aus. Die einhellige Meinung war, dass Hilal eine glänzende Perle sei, die Karoline am Saum des Atlantiks aufgelesen habe. In ihrer Welt erhob sich zwar die eine oder andere Stimme, teils hinterrücks lästernd, teils offen und wohlwollend hinterfragend, ob sie diesen Traummann möglicherweise etwas zu heftig herumkommandiere, aber er selbst schien dies nicht so zu empfinden. Um es Karoline recht zu machen, war Hilal kein Handschlag zu viel, kein Weg zu weit, keine Mühe zu schwer, kein Dienst zu gering. Die Hingabe, mit der er diese Frau anhimmelte, war schrankenlos.
Als Karolines Vater, ein wohlhabender Handwerksmeister mit eigenem Betrieb - Heizung und Bäder -, starb, waren die Brüder, die das Familienunternehmen fortführen wollten, gezwungen, ihr aus der Erbmasse 300.000 Euro auszuzahlen. Die Hälfte davon war gleich in den Kauf eines alten Bauernhauses am Stadtrand geflossen, das Karoline und Hilal kurz vor dem Ausbruch seiner Erkrankung bezogen hatten und in dem die beiden begonnen hatten, für sich ein uriges, dabei komfortables und stilvolles Nest zu gestalten. Sie hatten ein paar Antiquitäten, rustikale Eichenschränke und einen Refektoriumstisch, erworben und diese Stücke mit modernen Objekten, zum Beispiel lässigen, mit weißem Nappaleder bezogenen Sitzgruppierungen, zwei, drei innovativen Hightech-Multimedia-Installationen und großformatigen abstrakten Acrylgemälden, auf denen Farbe und Bewegung geradezu explodierten, spannungsreich in Kontrast gebracht.
Nach der Zeremonie am ausgehobenen Grab, bei der Hilal - immer noch in den von seinen Schwagern gebildeten Schraubstock eingezwängt - wohl nur noch körperlich anwesend war, wurde er von zwei Sanitätern übernommen, die ihn auf einer Bahre davontrugen. Hilals Eskortierung hatten Karolines Brüder nur äußerst widerwillig wahrgenommen; da ihm die Position am Kopf der Trauerprozession allerdings nicht streitig gemacht werden konnte, sie ihrerseits aber den nahen Grad ihrer Verwandtschaft mit der Toten betonen und ebenfalls in vorderster Linie mitgehen wollten, konnten sie diese Aufgabe nicht anderen, ihm freundlicher zugetanen Begleitpersonen überlassen - Lehrerkollegen Karolines etwa oder Spielerinnen ihres Vereins, die dies, wenn es denn schon gegen jede Vernunft so sein sollte, gern und hingebungsvoll übernommen hätten.
Wieder im Krankenhaus, in den Tagen nach Karolines Grablegung, waren die engsten Freunde bei ihren Besuchen zwar bemüht, ihn vor der Wahrheit über die näheren Umstände ihres Todes abzuschirmen, aber Hilal hatte doch ein Gespür dafür, dass ihm wesentliche Details vorenthalten wurden. Der aufzehrende Überlebenskampf, die körperliche Hinfälligkeit, die verebbenden Seelenregungen und die medikamentöse Benommenheit vermochten den Schock vielleicht etwas zu dämpfen; er sprach nicht viel, murmelte nur leise immer wieder vor sich hin: warum, warum, wieso. Irgendwann aber, nach Wochen, wurde seine Stimme fester und er begann in die Besucher zu dringen, nun endlich mit Einzelheiten über Karolines Tod aufzuwarten. Marion schließlich, ihre anhänglichste Vertraute, fand, dass die Geheimnistuerei nicht länger aufrechterhalten werden könne. Sie klärte Hilal restlos auf.
Читать дальше