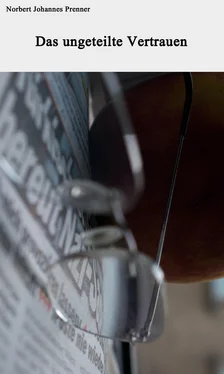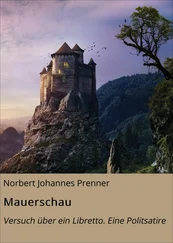Norbert Johannes Prenner
Das ungeteilte Vertrauen
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Norbert Johannes Prenner Das ungeteilte Vertrauen Dieses ebook wurde erstellt bei
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Impressum neobooks
Die Aussicht
Man schrieb den 24. April 1947. Obwohl es kaum etwas zu essen gab und der Hunger nach Information eben so groß war wie der nach einer ordentlichen Mahlzeit, begnügte sich Erich an diesem Tage damit, sich an irgendeinem Kiosk anzustellen, um ein Exemplar der „Österreichischen Zeitung“ zu ergattern, die paradoxerweise zwar den Namen der wiedergewonnen Heimat trug, aber keine österreichische Zeitung war. In letzter Zeit war die Aufregung unter der Bevölkerung über die bevorstehende Rückkehr aller deutschen Kriegsgefangenen groß, da die Außenminister der Großen Vier nach langem Hin und Her übereingekommen waren, sämtliche in Russland zurückgehaltenen deutschen Gefangenen in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, wonach alle hofften, dass ihre seit langem vermissten Familienangehörigen oder Freunde dabei sein könnten.
Erich erstand also für seine letzten Groschen ein Exemplar jenes Sprachrohres der Roten Armee, in dem Bewusstsein, dass diese Zeitung von einem in Moskau zusammengestellten und ausgebildeten Team von Offizieren redigiert worden war, und in der Hoffnung, dass diese Zeitung am neuesten Stand der Informationen war, obwohl das „Neue Österreich“ dieser Zeitung in der Lesergunst längst den Rang abgelaufen hatte. Mit der Zeitung unterm Arm begab er sich schnurstracks ins Café Bräunerhof und ließ zunächst einmal beim Ober einen kleinen Schwarzen anschreiben, denn als Redakteur war er dort ein gern gesehener Gast und aufgrund der Tatsache, dass er stets die neuesten Nachrichten mitbrachte, auch kreditwürdig. Um 15 Uhr würde er seine Frau am Stephansplatz treffen, so blieben noch ganze zwei Stunden bis dahin, und die gehörten ihm, ihm ganz alleine, in seiner Hoffnung, dass die Verantwortlichen dieser Welt den dringenden Appell Papst Pius des XII. zur Wahrung der Moral und der Einigkeit ernst nehmen mochten, um die Gegensätze, die sich auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem und vor allem kulturellem Gebiet in den letzten Jahren entwickelt hatten, auf einen Nenner zu bringen.
Zustände, vor denen selbst die mutigsten Menschen in den letzten Jahren erschaudern mussten. Seit dem Einzug der Amerikaner, Briten und Franzosen im August 1945 hatten die drei Westalliierten vergeblich versucht, in ihrer Besatzungszone eine starke, mediale Hegemonie zu errichten, wobei sie neben ihren Zeitungen auch die Rundfunkstationen Rot-Weiß-Rot und Alpenland betrieben. Zusätzlich zur Österreichischen Zeitung der Russen fungierte der von Amerikanern gegründete Wiener Kurier als Sprachrohr britischer Vormundschaft. Das hatte man nun davon. Amüsiert über den Bericht vom Staatsbankett im Kreml, bei dem angeblich nichts von all´ den Spannungen bemerkt wurde, welches Stalin mit einem Trinkspruch eröffnet hatte, und bei dem Molotow ihn mit zwanzig Trinksprüchen wohl zu übertreffen gedachte, bestellte er ein Glas Wasser und war sich darüber im Klaren, dass die frommen Wünsche der Amerikaner nach einer raschen Lösung solche bleiben würden, und zwar für längere Zeit.
„Was meinen Sie, Herr Franz, wie lange werden uns die in Moskau noch an der Nase herumführen?“ fragte er den Ober. „Also, wenn Sie mich so fragen, Herr Doktor, dann kann ich nur eins sagen, ein Kompromiss wird´s werden, mehr dürfen wir nicht erwarten, Sie werden sehen! Aber - wenn ich die dummen Sprüch´ von den Engländern schon hör´, dass es keinen Grund gibt, dass Österreich nicht ein blühendes Land werden könnte, dann vergeht´s mir, wenn Sie wissen was ich meine!“ „Ja, natürlich“, entgegnete Erich nachdenklich, vergeblich in seinen Taschen nach einer Zigarette kramend. „Nehmen´s eine von mir, Herr Doktor, bitte! Sie sind ja Stammkunde g´wesn, immer schon, hoffentlich bleiben´s uns auch in Zukunft treu!“ Erich bedankte sich höflich und bat um Feuer. „Und noch was sag´ ich Ihnen.
Wenn die Russen nicht so arrogant und verstockt wären und nicht alles blockieren täten, dann hätt´ ma schon längst unsern Vertrag und a Ruh´ wär, finden´s nicht?“ „Sicher. Im Zeitschinden sind sie einmalig auf der Welt. Leider wird auch die Kluft zwischen den beiden Großen immer gewaltiger. Überall nur Krisen. Die griechische, die türkische und weiß der Teufel noch welche!“ „Wem sagen Sie das, Herr Doktor. Und dabei versichert man und uns täglich, dass weder die Russen, noch die Herren Amerikaner einen neuen Krieg wünschen.“ „Eben. Zwei Jahre dauert das Debakel um den sogenannten dauerhaften Frieden nun schon. Bis jetzt sind sie in ihren Verhandlungen über theoretisches Bla-Bla nicht hinausgekommen. Jetzt brauchen wir den Truman, der uns mitteilt, dass mit der Bergpredigt vor 2000 Jahren bereits alle Voraussetzungen für einen dauerhaften Völkerfrieden geschaffen worden sind!“ Beide lachten herzlich.
„Das ist wirklich ein guter Witz, Herr Doktor, nur glaub´ ich, wird das die gottlosen Russen einen Dreck kümmern, wenn Sie verstehen, was ich mein´.“ „Da haben Sie auch wieder Recht, Herr Franz. Wie ich immer sag´, der Russ hat noch was ganz Anderes vor, sonst täten die nicht so darauf drängen, dass die Amis hier möglichst bald wieder abziehen und gar ihnen das Territorium überlassen. Bei dem Gedanken fühl´ ich mich gar nicht wohl. Sie doch auch nicht, oder?“ „Na, das können´s glauben. Aber – nicht bös´ sein Herr Doktor, ich muss – dort drüben, Kundschaft!“ Erich wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Zumindest brauchte er heute nicht vor 17 Uhr in der Redaktion sein. Er war in Sorge, dass das Papier für die Abendaus-gabe wieder nicht reichen würde. Der Volksstimme ging es da schon besser, die wurden von den Sowjets mit den Lieferungen bevorzugt behandelt. In der Regel ging es ohnehin bloß um vier Seiten, die in den alten Maschinen, mühsam zusammengeflickt, gesetzt und gedruckt wurden. Und wenn schließlich alles funktionierte, konnte man nur hoffen, dass es keinen Stromausfall gab. Wer von den Journalisten nicht das Glück hatte, für eine Besatzungsmacht zu schreiben, musste seine Artikel eben mit leerem Magen verfassen, und das Hungergefühl verstärkte sich nach Redaktionsschluss nur noch mehr, wenn es nicht vom Arbeitsstress verdrängt wurde.
Danach ging man nach Hause, in der Hoffnung, nicht vom großen Unbekannten überrascht zu werden, über dessen Untaten man zuvor lang und breit berichtet hatte. Dabei gehörte Erich noch zu den Glücklichen, einen Arbeitsplatz zu haben, auch wenn dabei ein Teil seines Lohnes nur in Naturalien abgegolten wurde, die mit Geld gar nicht zu bezahlen gewesen wären. Immerhin, man konnte genug Brot und Gemüse, zwar kaum Fleisch, jedoch Fett, Zucker, Milch- und Eipulver bekommen, und – es gab Zigaretten und Kaffee von den Amerikanern. Erich blickte über den Rand seiner Brille und sah s i e lange an. Sie war dunkelhaarig, schwarzes Kostüm, Mitte vierzig, schien groß und schlank und saß an einem kleinen Tisch am straßenseitigen Fenster. Sie blätterte offensichtlich bloß so zum Schein in einer Broschüre, ohne richtig darin zu lesen und rauchte. Aus dem Volksempfänger konnte man leise Straußwalzer hören. Erich schrieb ein paar Notizen auf den Zeitungsrand, die ihm für die bevorstehende Redaktionssitzung wichtig schienen, die Dame in Schwarz immer wieder beobachtend.
Читать дальше