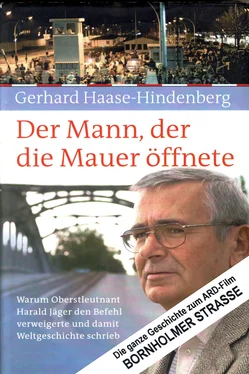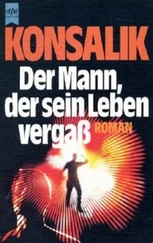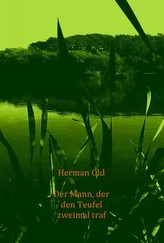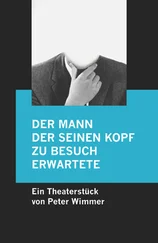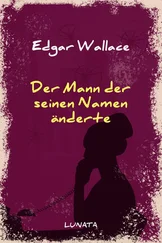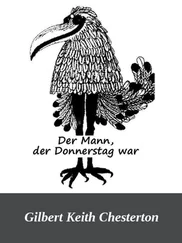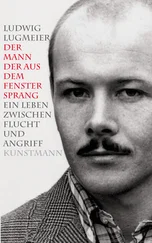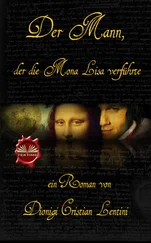Der junge Mann neben ihm bleibt heute stumm. Dabei gäbe es gerade an diesem Abend einiges, worüber es sich zu sprechen lohnte. Ab heute nämlich, so glaubt Harald Jäger, würde vieles nicht mehr so sein wie vorher. Der Staat hatte sich erpressen lassen, hatte klein beigegeben vor ein paar tausend Leuten. Immer wieder drängen die Bilder aus der heutigen „Tagesschau“ vor sein geistiges Auge. Das vom westdeutschen Außenminister auf dem Balkon der BRD-Botschaft in Prag. Wie er mit heiserer Stimme und unverkennbaren Hallenser Dialekt verkündet, dass es den Besetzern erlaubt sein würde, in den Westen auszureisen. Die der Botschaftsflüchtlinge, wie sie sich jubelnd und weinend in die Arme fallen. Und er hört wieder und wieder die Stimme seiner Frau, die neben ihm kaum hörbar „Wirtschaftsflüchtlinge“ murmelt. Einer Souffleuse gleich, nur dieses eine Wort. Als ob es so einfach wäre. Wer setzt schon für ein paar amerikanische Jeans oder den Traum von einem schnellen Auto die eigene soziale Sicherheit aufs Spiel? Und die seiner Kinder? Da müssen noch andere Gründe eine Rolle spielen. Aber welche? Der Oberstleutnant ist froh, dass ihn der Oberleutnant diesmal nicht danach fragt.
Der Film „Zu jeder Stunde“, den Harald Jäger im Frühjahr 1960 im Bautzener Central-Kino sieht, wird für den siebzehnjährigen Ofensetzerlehrling zu einer Art Erweckungserlebnis. Die Geschichte einer Grenzpolizeieinheit an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern, war von der DEFA als die einer gut ausgebildeten, bewussten Truppe an der Nahtstelle „zwischen Arbeitermacht und Klassenfeind“ propagandistisch in Szene gesetzt worden. Es ist nicht die erste Begegnung des Jugendlichen mit der Existenz der Grenzpolizei. Schließlich hatte sich sein Vater schon ein Jahrzehnt zuvor für drei Jahre zum Grenzdienst verpflichtet. Nicht ganz freiwillig – in einem Kriegsgefangenenlager östlich des Ural. Vier Jahre nach dem Ende des Krieges. Der kleine Harald war stolz auf dessen Uniform, nachdem er sich erst einmal erschrocken von dem fremden Mann abgewandt hatte, der dürr und abgerissen aus der Weite Sibiriens in die Bautzener Arbeitersiedlung Herrenteich zurückgekehrt war. Und in seiner Schule war ein Waldemar Estel zum Helden hochstilisiert worden.
Die „Heldentat“ des Waldemar Estel hatte darin bestanden, einen todbringenden Fehler zu begehen. Am 3. September 1956 hatte der dreiundzwanzigjährige Grenzpolizist einen Mann festgenommen, der vom Westen aus ins Grenzgebiet eingedrungen war, ohne diesen nach Waffen zu durchsuchen. Das aber war den Bautzener Volksschülern nicht erzählt worden. Harald Jäger wird diesen Hintergrund erst erfahren, wenn es die Grenze, die Waldemar Estel hatte schützen wollen, nicht mehr geben wird.
Letztlich aber seien es Oberleutnant Hermann Höhne und seine Truppe in jenem DEFA-Streifen gewesen, die ihn veranlasst hätten, sich nach Abschluss der Lehre freiwillig zum dreijährigen Grenzpolizeidienst zu melden. So jedenfalls wird er es später seinen Kindern erzählen.
Abend für Abend stellt sie sich ein – diese von ihm als angenehm empfundene Zwischenzeit. Jene fast feierabendliche Ruhe vor dem nächtlichen Sturm. Wenn nur noch einem beschränkten Personenkreis Einlass gewährt wird und die ersten Tagestouristen bereits die Heimreise antreten. Auf halbem Wege zwischen der Vorkontrolle/Einreise und seinem Büro dort unten in der Dienstbaracke bleibt Oberstleutnant Jäger stehen und lässt diese Stimmung auf sich wirken. Vor sich das riesige Areal der Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße. Aus dieser Entfernung wirken seine Passkontrolleure selbst dann wie militärisch agierende Marionetten, wenn sie nur wartend herumstehen. Er bekommt eine Ahnung davon, wie diese ihm so vertrauten Menschen auf die Einreisenden aus jener anderen Welt wirken müssen, die dort hinten jenseits der Brücke liegt. In aller Regel dauert das Zusammentreffen nur einen kurzen Augenblick, selten mehr als einige Minuten. Doch wird es von den Beteiligten aus völlig unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen. Sogar aus gegensätzlichen. Der Reisende, der den Grenzübertritt möglichst schnell hinter sich bringen will, trifft auf den Uniformträger, der eine ganze Reihe von dienstlichen Anweisungen zu beachten hat. Eine antagonistische Begegnung, welche die Fremdheit zwischen den Beteiligten eher noch fördert. Dies erklärt auch, weshalb die Einreisenden sich dann oft auskunftsbereit zeigen, wenn sie ein freundlicher Oberstleutnant scheinbar zufällig in ein Gespräch verwickelt. Sie wissen nicht, dass man nur deshalb an ihren Personaldokumenten „eine Unregelmäßigkeit überprüfen“ muss, weil ihr Wohnort in der Nähe eines amerikanischen Raketenstandorts liegt. Oder in der einer bedeutenden Waffenschmiede. Weil sie zufällig den Gehaltsstreifen einer Behörde bei sich tragen. Oder auffallend viele Einreisestempel der USA im Pass haben. Sie ahnen sicher auch nicht, dass in dem gemütlich eingerichteten Büro, in welches sie der Offizier beiläufig bittet, die scheinbar private Unterhaltung aufgezeichnet wird. Würden sie sonst so freimütig erzählen, von Problemen am Arbeitsplatz bis zum letzten Geschlechtsverkehr? Aber auch über Dinge, die vielleicht den noch fehlenden kleinen Stein in einem großen Puzzle bedeuten. Im Nebenraum sind die Ergebnisse dieser Gespräche auf unzähligen Karteikarten festgehalten, deren Existenz selbst nach den Gesetzen der DDR illegal ist – stets zur Verfügung der landesweit operativ tätigen Mitarbeiter. Manch ein Besucher aus Heilbronn oder der Ingolstädter Gegend wurde so unfreiwillig und ahnungslos zum Informanten des Staatssicherheitsdienstes.
In einer halben Stunde wird, zaghaft zunächst noch, der Rückreiseverkehr beginnen, der sich dann bis Mitternacht deutlich steigern wird. Bis dahin nämlich müssen die BRD-Bürger, die hier Stunden zuvor in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik eingereist sind, diese genau hier auch wieder verlassen. Und weil die DDR mit Hinweis auf „Geist und Buchstaben des Vierseitigen Abkommens“ einen völkerrechtlichen Unterschied zwischen BRD-Bürgern und denen aus Berlin-West macht, dürfen sich letztere mit der Heimreise zwei Stunden länger Zeit lassen. In jedem Fall aber werden unter den Rückreisenden auch heute wieder „alte Bekannte“ des Harald Jäger sein. Bürger deren Namen man bei der Einreise in der Fahndungskartei gefunden hat. Nicht jeder der dort registriert ist, muss zurückgewiesen und kaum einer gar festgenommen werden. Oftmals genügt es, zum Telefonhörer zu greifen und die Genossen von der VIII zu informieren. Diese Zivilkräfte übernehmen dann jene Aufgabe, wofür die „Hauptabteilung VIII“ beim Minister für Staatssicherheit nun einmal verantwortlich ist: Observation und Ermittlung. Diese fürsorgliche „Rundum-Betreuung“ endet, wenn das „Beobachtungsobjekt“ schließlich wieder an den Grenzübergang zurückkehrt. Dorthin, wo es irgendwann im Laufe des Tages eingereist war. Vorausgesetzt, es hat in den Stunden dazwischen nicht gegen die Gesetze der DDR verstoßen.
Es hatte einige Sekunden gedauert, ehe der achtzehnjährige Grenzpolizist Harald Jäger die Situation erfassen konnte. Ein lang gestreckter Sirenenton, zwei Sekunden, ebenso lange Pause, dann von vorn. Es war eindeutig das Signal für den Gefechtsalarm, welches ihn und seine Stubenkameraden aus dem Tiefschlaf gerissen hat. Nicht das für den Grenzalarm, der in den Wochen zuvor wieder und wieder als Übung angesetzt worden war. Kurz darauf hallten auch schon die Trillerpfeifen der Unteroffiziere durch die Flure. Dann deren Ruf: „Gefechtsalarm“.
Fast gleichzeitig sprangen die jungen Burschen aus dem Bett, keiner von ihnen älter als zwanzig Jahre. Mechanisch schlüpften sie in ihre Uniformen, griffen zu Stahlhelm und Truppenschutzmaske, ehe sie die Treppe zur Waffenkammer hinunterstürzten, um Maschinenpistole oder Karabiner in Empfang zu nehmen. Das alles hatten sie zuletzt im Frühjahr geübt, während der Grundausbildung. Danach hatte man ihnen gesagt, dass der Gefechtsalarm künftig den Soldaten der NVA vorbehalten bleiben würde – außer im Ernstfall!
Читать дальше