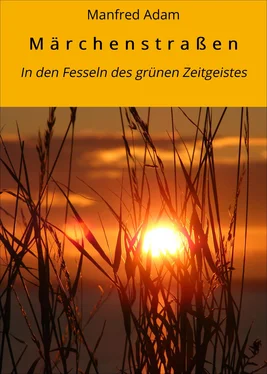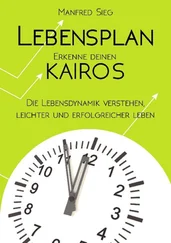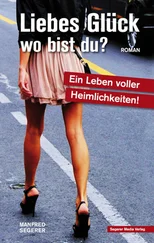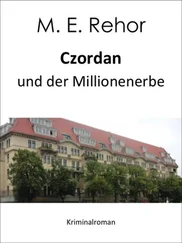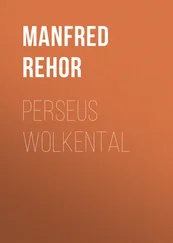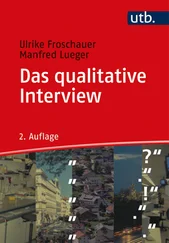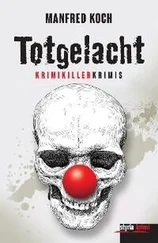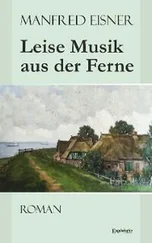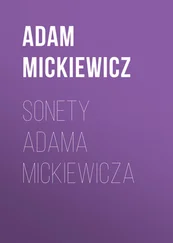Das hat nicht immer jeder Oberkoch durchschaut. Den grün gewandeten Beiköchen war es nicht ohne Grund so wichtig, dass an jeder frühzeitigen Früh-Vorinformation immer gleich von Anfang an jene Mitköche beigeladen waren. Auch jene, die nach ihrer Aufgabenbeschreibung ebenfalls dem Brei zum Erfolg verhelfen sollten, die aber aus ganz anderen Gründen auf ihrer ausnahmslosen Frühbeteiligung bestanden. Sie wollten Zeit genug bekommen für das Aufmunitionieren und das Einschießen für den Fall, dass ein unliebsames Breirezept vor der Streichung aus dem Menuplan öffentlich werden sollte.
Hinter dem positiv besetzten Zauberwort Teamwork ist vieles versteckbar. Auf den ersten Blick klingt dessen Vorzug hell einleuchtend. Aber nur, wenn seine Möglichkeiten nicht hinterrücks missbraucht werden. Leider verstehen es geschickte Strategen bei strittigen Zielen und Rezepten die Vorteile heimlich in Nachteile umzuwandeln. Als einst der Struwwelpeter sagte "Diese Suppe will ich nicht", war sie immerhin schon gekocht worden und seine Geschwister haben ihren Teil auch verspeist. Heute sind die Struwwelpeters schlauer. Sie versuchen, ihre antiautoritären Köche gleich von vornherein davon abzuhalten, dass die Suppe überhaupt gekocht wird. Da gibt manche liebe Mutter nach und sagt, ich hätte sie zwar gern gegessen, aber wenn mein Töchterlein sie nicht will, verzichte ich eben auch.
Im Grunde sind heute viele Kochkonferenzen so zu sehen. Der nicht ausreichend in die Kniffe involvierte Restaurantchef verlangt, dass stets eine große Schar von Fachfremden eingeladen wird, um die Diskussion schön bunt zu gestalten. Diese besonders diskutierfreudigen Leute sind besonders wichtig, weil sie stets so weit abweichende Ziele in die darauf endlosen Diskussionen einbringen, dass hinterher nicht der Eindruck entstehen kann, es sei um eine einfach gewesene Problemlösung gegangen.
Wer das Verfahren kennen lernte, war hinterher zumeist bass erstaunt, welch fortschrittliche Zielverschleierungsmethoden hier zur Anwendung gekommen sind und welch geschickte Leute an dieser Art von Kocherei beteiligt waren. Man nannte die Verfahren neutral "Mitarbeiterführung", damit es freundlicher klingt und die eigentlichen Absichten nicht schon aus der Bezeichnung herauslesbar waren. Bei erfolgreichen Firmen versteht man darunter etwas ganz anderes, nämlich eine „durch Interaktion vermittelte Ausrichtung des Handelns von Gruppen auf die Verwirklichung vorgegebener Ziele“. Dabei liegt die Betonung auf letzterem. Bei manchen Behörden stehen andere Dinge im Vordergrund, nicht das Ziel und auch nicht so einfach der Weg dorthin, sondern die Möglichkeiten der Wegsperrungen, Abzweigungen, Sackgassen und Umleitungen dorthin.
Was so alles zugegeben werden muss …..
Erfahrungsgemäß dauert es immer eine gewisse Zeit, bis jeder Beisitzer zu jedem Thema seinen Senf beigegeben hat. Wir unternehmen hier mal einen kleinen Ausflug in die Trivialliteratur, um uns zu dieser Thematik ein Beispiel anzusehen. Nur so zur Auflockerung, weil das Hauptthema dieses Buches aufgrund der Hoffnungslosigkeit sonst mehr zum Weinen als zum Lachen ist. Bei Karl May kullern in der folgenden Geschichte auch die Tränen, weil der Erzählung nach ein Konsument über die Inhaltsstoffe einer angebotenen Speise arglistig getäuscht worden ist. Es hat aber im tieferen Sinne auch viel mit Vertrauen zu tun. In dem Karl May-Band „Der Ölprinz“ wird das so humorvoll beschrieben, dass es hier in Auszügen mal zitiert werden soll. Begeben wir uns dazu in den wilden Westen und hören zwei aus Sachsen stammenden Westmännern zu, die sich am Lagerfeuer folgendes auf sächsisch erzählten:
„…. Also diese beeden Indianer waren von ihrem Schtamm nach Washington gesandt worden, um dem großen weißen Vater eenige Wünsche ihres roten Volkes vorzutragen. Als Gesandtschaft mussten sie nobel behandelt werden und wurden daher zum Abendessen beim Präsidenten eingeladen. Sie saßen da nebeneinander an der Tafel, mit vielen Schpeisen, die sie im Leben noch nich gesehen, noch viel weniger aber gegessen hatten. Da raunte der alte Indianer dem Jungen listig zu “mein junger roter Bruder mag mit mir offpassen, wovon die Bleichgesichter am wenigsten nehmen, das ist die teuerste und köstlichste Schpeise, da langen wir tüchtig zu“.
Sie gaben also acht und bemerkten bald, dass am allerwenigsten von einer hellbraunen Schpeise genommen wurde, die sich in kleenen feenen Gläsern auf silbernen Untersetzern befand. Da meente der Alte zu dem Jungen „mein junger Bruder kann een solches Glas erreichen, er mag sich zuerst davon nehmen“. Der junge Indsman zog sich das Glas heran, nahm eenen gehäuften Löffel voll direkt in den Mund und rasch danach noch eenen zweeten. Dann blickte sich der Rote um, ob das jemand bemerkt habe. Keen Mensch guckte her. Erscht nun begann er, die köstliche Schpeise mit der Zunge zu zerdrücken und der Alte sah ihm dabei voller Spannung ins Gesicht. Dieses wurde nach und nach gelb, rot und grün. Aber es blieb schtarr und unbewegt, denn een Indianer darf selbst bei argen Schmerzen nich mit der Wimper zucken. Aber die Oogen wurden immer schtarrer bis sie anfingen zu tränen und das Wasser schtromweise über die Backen herunterlief. Da machte der junge Indsman eenen todesmutigen Schluck und hinunter war der Senf.
Da fragte der alte Häuptling neugierig „warum weint mein junger roter Bruder?“ Dieser hätte um alles in der Welt nich eingestanden, dass ihm die köstliche Schpeise so off das Gemüt gegangen war und darum antwortete er „ich dachte eben daran, dass mein Vater vor fünf Jahren im Mississippi ertrunken ist“. Bei diesen Worten schob er das Glas dem alten hin. Dieser hatte gesehen, wie schlau sein junger Bruder war und machte es ebenso. Aber dann gingen ihm die Lippen wieder auseenander und klappten auf und zu wie bei eenem Karpfen, der keine Luft mehr bekommen kann. Die Farbe seines Gesichtes veränderte sich wie bei eenem Chamäleon und der Schweiß quoll ihm aus allen Poren. Die Oogen wurden rot und füllten sich mit eenem See von Tränen, der bald überlief und die Fluten über die Backen hernieder goss. Das sah der Junge und fragte mitleidig „Warum weint mein alter Bruder?“ Da schluckte dieser mit Aufbietung seiner ganzen Willenskraft den Senf hinunter, holte tief und schtönend Atem und antwortete „ich weine darüber, dass Du damals nicht gleich mit ersoffen bist“.
So viel zur Ehrlichkeit beim Eingestehen von unerwartet falsch gelaufenen Dingen.
Vorköche, Versuchsköche und Vorkoster
Aber nun zurück zu den deutschen Kochkünsten, wo ebenfalls die Konsumenten oft über die Wirkstoffe der angebotenen Speisen arglistig getäuscht werden. Auch hier kam es schon vor, dass Entscheider nach schlechter eigener Erfahrung spätere Nachfolger eher ins offene Messer laufen ließen, als ihnen Hinweise zur Umschiffung der Klippen auf den Weg zu geben. Mit letzterer Hilfestellung hätte man ja zugegeben, dass man selbst zuvor allzu lange auf dem Holzwege umher geirrt war.
Gibt es Vergleichbarkeiten zur A44-Planung? Sicherlich! Vielleicht! Nein! Auskunft verweigert. Das kann eigentlich nur jemand beurteilen, der vom planen und kochen gleichermaßen viel versteht. Und welche Köche würden in diesem Gleichnis welchen Funktionen entsprechen? Nicht so einfach, denn die Bearbeiter und Leiter aller Ebenen haben im Verlaufe von über zwanzig Jahren extrem oft gewechselt, in Eschwege, Kassel und erst recht in Wiesbaden. Aber mit zwei Ausnahmen, zwei Romanfiguren unter mehreren Dutzend. Nämlich dem erwähnten technischen Planer Mandamo Adler und dem geadelten Umweltplaner Wernher von Rosenbusch (letzterer späterhin mit einem Wechsel in eine andere Funktion). Zwei gleichermaßen engagierte Leute der ersten Stunde. Integer und anerkannt in ihren Fächern. Nur mit dem Kochen hatten sie es beide nicht so. Kaffee haben sie aber hingekriegt.
Читать дальше