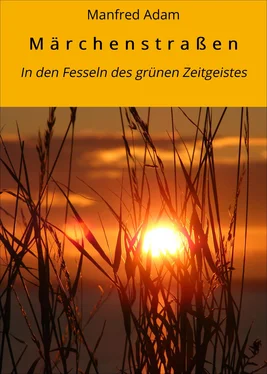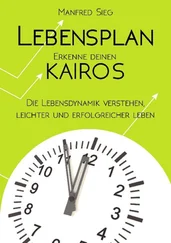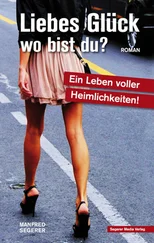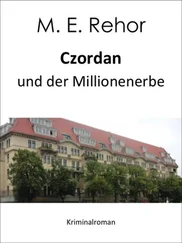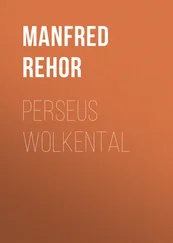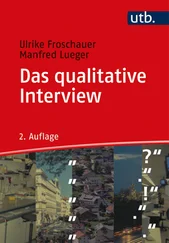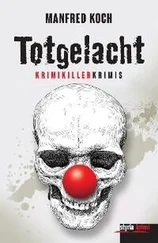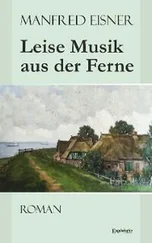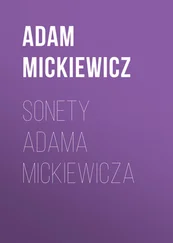Fliegen tun die lieben Grünen auch gern. Besonders wenn es auf Staatskosten geht. Und nicht nur wenn sie gerade Bundesaußenminister sind, wie einst Joschka. Auch andere Grüne finden durchaus viele Anlässe für In- und Auslandsreisen. Klar, auch die Abgeordneten anderen Parteien fliegen auf Staatskosten, aber die widersprechen sich nicht selbst, da sie die Fliegerei nicht so verteufeln wie die gelernten Ökos der unteren Ebenen.
Was sind gelernte Ökos? Jene engelsgleichen Gutmenschen mit mehr oder weniger ungewissen Fragmenten von Teilkenntnissen zu nichtkausalen Zusammenhängen. Der frühere innenpolitische Sprecher der Grünen in Berlin, Vorzeige-Multikulti und Vielflieger Cem Özdemir, hat im Jahre 2002 die dienstlich erworbenen Bonusmeilen privat genutzt. Die „Bild am Sonntag“ berichtete damals dazu, der geldwerte Vorteil habe mehrere tausend Euro betragen. Cem räumte den Missbrauch der Bonusmeilen ein und trat von seinen Ämtern zurück. Zuvor hatte er auch einen günstigen Großkredit vom PR-Berater Hunzinger angenommen, den seine Partei vorher als Finanzhai kritisiert hatte. Zu diesem hatte auch schon der damalige Bundesverteidigungsminister Scharping/SPD unklare finanzielle Beziehungen und war deshalb entlassen worden. Özdemir blieb. Erwähnenswert ist die Konzentration auf die grünen Fehlleistungen ja auch nur im Zusammenhang mit dem Anspruch der Grünen auf eine höhere politische Moral.
Nach zwei Jahren Erholung und Runderneuerung wurde Özdemir schon in 2004 wieder als Parlamentarier aktiv, er wurde in das Europäische Parlament nach Straßburg gewählt. Seit 2008 ist er Bundesvorsitzender von „Bündnis 90/Die Grünen“. Ob der Vielflieger Cem auch gegen Autobahnplanungen stimmen würde, hat er damals nicht direkt gesagt, ist aber wahrscheinlich.
Viele Köche verderben den Brei
Zurück zu der Metapher von den vielen breiverderbenden Köchen. Mit diesem Gleichnis aus dem neuesten Testament der Köchebibel hatte Mandamo schon vor 2000 erstmals die Grundstruktur der grünen Verzögerungstaktiken gegen große Infrastrukturprojekte karikiert. Anfangs für einen ganz kleinen Diskussionskreis, doch genau aus diesem Grundstock entwickelte sich der vorliegende Roman.
Interessant ist der Vergleich mit den Superköchen aus dem folgenden Grund: Früher galt in den feinsten Restaurants die Regel, dass ein Koch, der eine Suppe versalzte oder ein Gericht anbrennen ließ, dieses anschließend selbst essen musste. Auch heute gibt es noch mindestens ein Restaurant in dem das weiterhin üblich ist, nämlich das des weltberühmten Spitzenkochs Paul Bocuse in Paris. Als Chef begründet er das damit, dass ein Koch, der Misslungenes selbst essen muss, sich das besser merkt. O, lá lá! Ansonsten beklagen die internationalen Tester, dass gerade so manche Hohepriester der Spitzenrestaurants in Arroganz erstarrt seien. Aber normale Durchschnittsgourmets haben als Zuschauer von außen Verständnis für die armen "Köche" bei Mac Donalds, Burger King, Subway und anderen Restaurants. Man kann heute nicht mehr jedem Koch/jeder Köchin das Missratene zum selber essen vorsetzen. So groß sind deren Mägen gar nicht und soviel Zeit haben sie auch nicht - und schließlich sollen sie ja auch nicht zu fett werden hinter den schmalen Tresen.
Leider ist es auch bei anderen Vermanschungen heute nur noch selten so, dass die eigene "Suppe" bei Ungenießbarkeit selbst ausgelöffelt werden muss. Für Fehlversuche aller Art übernehmen Experimentierer die Verantwortung dafür heute nicht mehr selbst. Vorbei die Zeiten, wo ein Baron von Münchhausen sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpfe ziehen musste, wenn er selbst hineingetappt war. Früher galt noch "selbst ist der Mann". Und wie ist das bei hausgemachter Schweinskopfsülze, die im Biohof von Bauer Obergrün schlecht geworden ist? Da soll es einen Knecht gegeben haben, der gepetzt hat, dass man ja den grünen Schimmel abkratzen und das Produkt aufkochen kann. Dann sieht es aus wie neu und kann serviert werden. Es ist doch Bioware von einem freiheitlich gehaltenen Schwein!
Am Breitopf ist das Problem die unterschiedliche Zielsetzung der vielen Köche. Bei allen Vorgängen mit gewisser gesellschaftlicher Relevanz herrscht vorgeblich Demokratie in Reinkultur. Das heißt, dass bereits lange bevor etwas in den Topf hinein kommt, in dem es gekocht werden soll, heiße Diskussionen darüber beginnen. Da sich daran die kommunikationsfreudigsten der Köche besonders beteiligen, dauern bereits die ersten Grundsatzdiskussionen unendlich lange. Zumal die in sehr geschickter Weise agierenden Unter-, Neben- und Hilfsköche erst mal lange um den heißen Brei herumreden, um dabei auszuloten, wie, wo und wann sie ihren eigenen Einfluss auf die Breikocherei möglichst unauffällig, aber nachhaltig einbringen können. Nachhaltig ist das Zauberwort unserer Zeit. In diesem Planungsstadium spucken sich die grünen Köche ständig gegenseitig in die Suppe, meist heimlich, manchmal aber auch offen. Richtig gelesen, die grünen Köche untereinander! Zu dieser Zeit waren die andersfarbigen Köche noch kaum im Geschäft. Die werden erst in einem späteren Stadium an die Gemüsebreie gelassen.
Diskutieren kann man eigentlich nur in Gruppen mit mehr als einer Person, aber uneigentlich wollen die Grünlinge doch nur ihr eigenes Süppchen ungestört kochen. Da hindern Mitköche, die darauf hinweisen könnten, dass es noch keineswegs heraus ist, dass nur ein grüner Erbsenbrei bestellt werden wird. Dabei hat die Diskussion gerade erst begonnen. Zuerst sind die tiefschürfendsten Betrachtungen darüber anzustellen, welche Art Brei wollen wir denn dem Kochtopf überhaupt zumuten? Können wir nicht doch noch mal versuchen, statt des Breis ein anderes Süppchen zu kochen? Und zwar jeder sein eigenes? So wie Autofahrer ja auch wählen können zwischen Autobahnen und Feldwegen. Was, das hat uns die demokratisch gewählte Regierung nach Parlamentsbeschluss bereits fest vorgegeben, es soll eine Autobahn werden? Das ändert doch nichts daran, dass sich damit die Bei- und Nebenköche in handverlesenen Zirkeln trotzdem noch mal sehr kritisch auseinandersetzen. Aber nur in kleinem Kreise und darüber wird auch keinerlei Protokoll geschrieben und nichts posaunt. Wehe wenn doch ….
Die Bürger, die den Brei letztendlich bezahlen sollen und die verständlicherweise während der langen Diskussionen auch langsam Hunger bekommen, beginnen langsam ungeduldig mit den Füßen unter dem Tisch zu scharren. In Phase II wird feste darüber gestritten, welche Zutaten zum Brei zwingend erforderlich sind, welche wahlweise beigemischt werden können, was am gesündesten ist, was am besten schmecken und was am schnellsten fertig würde. Was der Brei am Ende kosten wird, interessiert dabei die akademischen Wissenschaftler der Biologie überhaupt nicht. Mit derartigen Niederungen der Planung sollen sich irgendwann andere Leute auseinandersetzen. Dass die dafür dann gar keinen Spielraum mehr haben, wenn das Rezept schon sooo weit vorgekocht ist, interessiert die hoch Gelehrten persönlich gar nicht. Das ist unter ihrer Würde, hat der Kochlehrling mal gehört.
Erhitzte Diskussionen um den heißen Brei herum
In dieser ersten Planungsphase gibt es also schon erste Konflikte zwischen den vielen Köchen. Denn jeder hat eine andere Geschmacksrichtung und er legt allergrößten Wert darauf, dass vor allem seine Ansicht auf das breiteste diskutiert und vor allem gewürdigt wird. In unserer grunddemokratischen Gesellschaft ist es erstes Bürgerrecht, ja geradezu eine Bürgerpflicht, sich in Diskussionen recht rege an allem zu beteiligen. Jeder muss zu jedem Aspekt irgendetwas sagen. Egal was - und auch wenn es nicht fundiert ist, von keiner Sachkenntnis getragen wird und auch wenn es mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat. Hauptsache reden. Am besten hinter verschlossenen Türen. Beton- und Ashaltplaner dürfen davon natürlich nichts hören,
Читать дальше