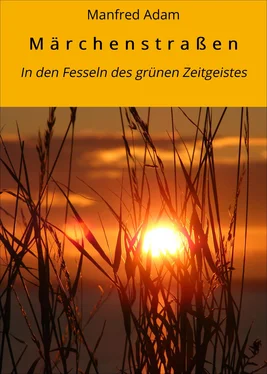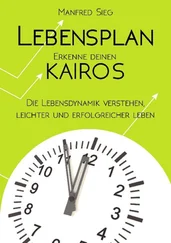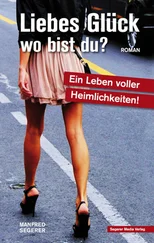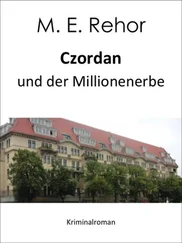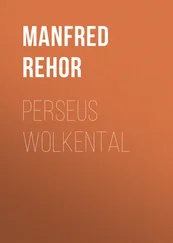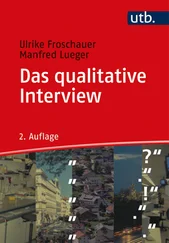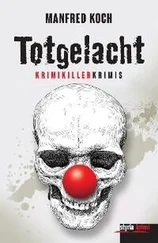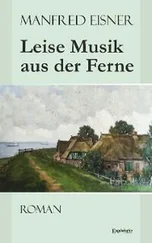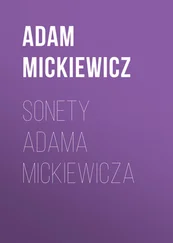Auf die A44 umgemünzt, hätten auch hier die viel kostengünstigeren Linienführungen gewählt werden müssen. Und zwar schon im Raumordnungsverfahren, dessen letzter Teil 1998 abgeschlossen wurde. Der Observer hat über den gesamten Planungszeitraum hinweg beobachtet, dass bei der A44-Planung die Kostenbegrenzung immer nur eine ganz untergeordnete Rolle gespielt hat. Darüber mögen sich im Nachhinein viele Steuerzahler aufregen, manche werden auch ausrufen „das darf doch nicht wahr sein“, aber lassen Sie sich das mal mit den dafür unvermeidlichen Einzelheiten darlegen.
Bevor wir uns in die ernstere Strenge heutiger Sachthemen begeben und dabei hier und da womöglich auch unfreundliche Emotionen auslösen, wollen wir erst noch ein wenig im Unterhaltsamen bleiben. Und uns auch noch ein paar Prisen Humor gönnen. Wir - der Observer und der Planer Mandamo - verpacken das schwer Verdauliche portionsweise in Metaphern, so ist es besser zu vertragen und zu ertragen.
Unzählige Widerstände führten zu langen Verzögerungen
Mit der breiten Variantendiskussion begannen die endlosen Debatten. Sie zogen sich über Jahrzehnte hin. Dennoch sei hier aus dem allerersten Zeitplan zitiert, dem von Mandamo aus dem Jahre 1990. Unter realistischer Berücksichtigung der Zeitbedarfe für Planungen, Ausschreibungen, Vergabeverfahren und einer maximal 4 jährigen Bauzeit (wenn alle Abschnitte gleichzeitig begonnen und keine Tunnel im Streckenzug enthalten sind) kam dieser Zeitplan zu einer Verkehrsübergabe spätestens im Jahre 2000! Politiker sprachen sogar von einer noch früheren Verkehrsübergabe. Manche sogar von 1995. Die hatten noch nichts von den vielen Fallstricken gehört, die Mandamo inzwischen schon am Horizont herannahen sahen.
Das Jahr 2000 war aber für die vollständige Fertigstellung einst wirklich realistisch! Der Netzplan enthielt sogar einige Puffer für Unvorhersehbares. So unglaublich das heute auch klingen mag. Lassen Sie uns nun mal gemeinsam die Unterschiede zwischen Anspruch und Ausführung zerpflücken.
Viele Köche verderben den Brei, sagt der Volksmund. Inzwischen ist das eine Metapher für viele missratene Vorgänge des täglichen Lebens. Nicht nur in der Küche, auch bezüglich der langwierigen A44-Planung drängte sich manchen Beobachtern und erst recht manchem Akteur im Planungsprozess der Eindruck auf, dass hier allzu viele Köche falsch geköchelt haben und dass deshalb das gute Gelingen so lange verhindert wurde.
Aber niemand sollte diese Aussage missdeuten. Es geht nicht darum, dass über Großprojekte nur ein einziger König hätte entscheiden sollen. Auch im sogenannten tausendjährigen Reich hat dessen Insignienträger, der österreichische Gefreite, beileibe nicht allein entschieden, direkt wahrscheinlich sogar überhaupt nichts. Zur Beplanung seines beeindruckenden Verkehrswegenetzes hat auch er eine "Projektgruppe" gehabt und darin befanden mehrere Fachleute über die Hauptmerkmale der Planung. Zu den heutigen Projektgruppen besteht allerdings der ganz wesentliche Unterschied, dass damals alle Beteiligten das gleiche Ziel ernsthaft verfolgten, nämlich dass am Ende ein verkehrlich sinnvolles, wirtschaftlich vertretbares und für Mensch und Natur akzeptables Autobahnnetz herauskommen muss.
Heute ist das leider anders. Heute mischen viele Köche mehr als Breiverderber mit, statt als nutzbringende Küchenhelfer. Bleiben wir beim Gleichnis. Es geht hier keineswegs nur darum, dass die „Geschmäcker verschieden“ sind. Altbundeskanzler Kohl mochte zwar Kohl, aber weder Grünkohl noch Rotkohl (in der Bundestagskantine). Diese Sorten stießen ihm immer sauer auf. Edmund Stoiber mochte außer den grünen Gemüsen auch die gelblichen nicht. Anders die Politiker mit den knallroten Krawatten, die mochten keine Schwarzwurzeln, auch nicht in gelber Soße. Die grünen Sonnenblumenträger waren ebenfalls allergisch gegen schwarzgelben Blumensträuße (z.B. mit Thunbergia alata) auf den Esstischen. Vor Wahlen wurden bisweilen diverse Farballergien bekundet. Hinterher wurde aber manchmal festgestellt, dass Aversionen auch relativierbar sind, wenn die Wahlergebnisse überraschenderweise dazu drängten.
Aber Geschmäcker und Farbkombinationen sind nicht nur ein politisches Problem. Nach jahrzehntelanger Erfahrung mit dem Metier der Autobahnplanung ist der Observer hin und her gerissen zwischen der Feststellung, dass allzu viele Köche den Brei verdorben haben und einer etwas differenzierteren Betrachtung dieser Aussage. Könnte man es in diesem Zusammenhang vielleicht etwas weniger drastisch ausdrücken? Immerhin ist es heutzutage nun mal gesetzlich so festgelegt, dass viele Köche am Brei mit herumrühren dürfen.
Die Bei- und Nebenköche üben also nur etwas aus, was ihr gutes Recht ist. Dass manche Köche besonders gern an besonders vielen Dingen zugleich herumrühren wollen, zeugt von deren Engagement und ist eigentlich - je nach Blickwinkel - nicht von vornherein etwas negatives. Jedenfalls wenn es nicht mit einer undemokratischen Absicht geschieht, also einem verdeckten Bestreben, mit Übereifer Dinge aufzuhalten, auszubremsen oder zu verhindern, die aus gesamtstaatlicher Sicht in einem demokratischen Prozess beschlossen worden sind.
Soll man jemandem, der ja „auch nur seine Arbeit macht“, seinen Übereifer mit anderem Vorzeichen, ankreiden? Manche Kritiker aus den Umweltverbänden machen diese Arbeit sogar ehrenamtlich. Das muss man doch im Prinzip eher loben. Zum Beispiel engagieren sich die Vertreter einiger Naturschutzinstitutionen so stark, dass aufgrund der fließenden Grenze zwischen Eifer und Übereifer, der Wendepunkt für Kritik nur schwerlich zu definieren ist.
Die engagierte Arbeit von Wissenschaftlern und Spezialisten aller Gebiete wird meistens honoriert. Manchmal sogar mit dem Nobelpreis. Wer aber wollte Alfred Nobel wegen seiner Erfindung des Dynamits kritisieren, womit z.B. Eisenbahntunnel durch Berge hindurch gesprengt werden konnten, mit dem man aber später auch Kanonen geladen hat. Und wer wollte die Flugpioniere verurteilen, wie z.B. Otto Lilienthal, der Grundlagen für den Flugzeugbau erforschte? Mit den danach weiterentwickelten Flugzeugen wurden später Bomben auf Menschen geworfen und heute fliegen mit dieser Erfindung sogar Umweltminister nach Mallorca zur Erholung, können dann innerhalb kürzester Zeit mal in Berlin zu einer Sitzung (vorbei-) kommen und dann gleich darauf wieder nach Mallorca zurückfliegen. Dass dies zur Umweltverschmutzung beiträgt, kümmerte ja lange Zeit kaum jemanden. Richtig heftig erst, seitdem die angeblich drohende Klimakatastrophe das neue Steckenpferd der Grünen wurde.
Und hat schon jemals ein Zeitgenosse die Konstrukteure Daimler und Benz dafür kritisiert, dass sie das Auto erfanden? Mit dessen weiterentwickelten Karossen (der Deutschen liebstem Kind) fahren heute selbst die Grünen gern und viel spazieren. Manche sogar in großen schwarzen Limousinen mit Chauffeur. Für eine sinnvolle und umfeldgerechte Nutzung der nach Zahl und Größe immens zunehmenden Fahrzeuge wurden außer den Zufahrtsstraßen zu ihren Garagen, auch Autobahnen gebaut. Und es sind immer noch welche zu bauen, weil die Verkehrsbelastung auf einzelnen Zubringerstraßen sonst für die betroffenen Anlieger unerträglich würde. Alle Medaillen haben also zwei Seiten.
Und ganz so überflüssig können ja die angeblich ignoranten Techniker gar nicht sein. Der populärste Grüne, der ehemalige grüne hessische Umweltminister und spätere Bundesaußenminister Joschka Fischer hat sich immerhin bei der Autofirma BMW, dem Energiekonzern RWE und dem Elektrokonzern Siemens, als Berater anstellen lassen. Siemens baute (auch) Atomkraftwerke und RWE betreibt sie. BMW pflegt das Image von besonders sportlichen Autos, die nicht gerade als umweltfreundlichste gelten. Wie passt das alles zu seinen vorherigen Verkündungen? Heute nennen die Ökoutopisten ihren einst dominanten Oberhirten spöttisch Gottvater.
Читать дальше