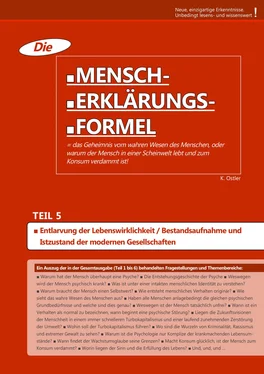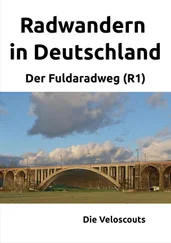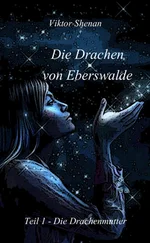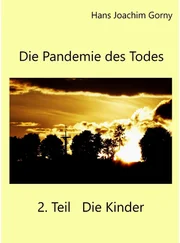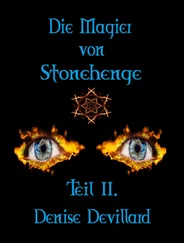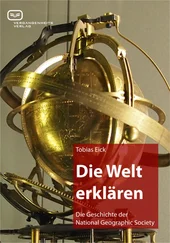Einige zielführende Fragen:
> Worin ist der Anlass zu sehen, dass ein Mensch einen großen Teil seiner Zeit vor dem Bildschirm mit Gewaltvideos und/oder -spielen verbringt?
> Welche Art von Befriedigung erfährt bzw. erhält er auf diese Weise? Warum benötigt er diese eigentlich? Von was muss er sich ablenken?
> Verkörpert diese Befriedigung nicht eine Ersatzbefriedigung? Wird also nicht ein Um- und Zustand saturiert, der, ursprünglich im Kindesalter, nicht gestillt oder durch Härte und Strenge gänzlich unterdrückt wurde (Stichwort: Bedürfniserfüllungen) und jetzt in einer stellvertretenden Form vollzogen werden soll?
> Was fühlt ein Mensch, wenn er eine todbringende Waffe in der Hand hält?
> Was soll mit dem Gewaltausbruch eines Amoklaufes bezweckt und dokumentiert werden?
> Und weswegen greifen nur wenige Menschen zur Waffe, obwohl sich viele Menschen in virtuellen Gewaltwelten bewegen und/oder ein ablehnendes Elternhaus haben? Bietet sich deshalb eine leichte, verallgemeinerbare Antwort diesbezüglich nicht an und ist sogar – scheinbar - auszuschließen?
Der Mensch möchte mit seiner Tat Macht und Stärke demonstrieren, Aufmerksamkeit erzeugen und Anerkennung Gleichgesinnter (Stichwort: Gruppenzugehörigkeit, Schicksalsgemeinschaft) bekommen, die ihm in seinem Alltag fehlen. Fehlen ist in diesem Zusammenhang sicherlich maßlos untertrieben, denn der Betroffene besitzt ein dies betreffend extremes Defizit, das sowohl sehr tief wie gleichfalls besonders breit in seiner Psyche verankert ist. Es damit nimmt einen großen Raum ein und ist folglich in der Kindheit entstanden, da, wie schon in mehreren vorherigen Kapiteln ausgeführt, ein erhebliches psychisches Defizit ausschließlich in der (Früh) Kindheit erwachsen kann.
Dieses Defizit bzw. identitätsgemäße Schwäche, die sich in der Regel anhand Negation und auch Unterdrückung elementarer Grundbedürfnisse im (früh) kindlichen Altersspektrum entwickelt hat und im weiteren Lebensverlauf mittels bestimmter Erlebnisse innerhalb der Identitätsproblematiken 3 und 4 noch potenziert wurde, hat es dem Betroffenen nicht ermöglicht, ein auf weiträumiger Basis fußendes, intaktes identitätsgemäßes Gleichgewicht aufzubauen.
Der defizitäre Bereich ist derart wesentlich und dominant, dass kein stabiles Fundament ausgebildet werden konnte. Dieses Befinden begleitet den Betroffenen sein ganzes Leben lang und belastet ihn außerordentlich in Gestalt eines enormen, unterschwelligen Leidensdrucks, der buchstäblich durch die erlittenen Erfahrungen implantiert wurde.
Das Pseudogleichgewicht ist auf starke Kompensationen und intensive Verdrängungsarbeit angewiesen, um die bestehende Fragilität vor den vorhandenen destruktiven Kräften und deren latent bedrohlicher Wirkung (in Form eines Zusammenbruchs) zu stützen, wie darüber hinaus nach außen eine gesellschaftskonforme Fassade aufrechterhalten zu können.
Aufgrund der entsprechenden Kompensationen und Verdrängungen, jedoch auch mangels der nötigen Sensibilität, Deutungsfähigkeit und Kontextherstellung, wird von der Außenwelt die tatsächliche innere Leere und Verzweiflung nicht wahrgenommen, sondern lediglich die errichtete, auf Überspielen und Täuschung ausgelegte, äußere Fassade. Diese ist einem Selbstschutz gleichzusetzen.
So berichtet das Umfeld in diesen Fällen oftmals im nach hinein von keinerlei oder bloß schwachen Anzeichen einer Störung und Problematik beim Amokläufer, er war normal, unscheinbar und/oder äußerst angepasst, obwohl er bereits – metaphorisch gesehen – eine zwar unsichtbare, aber bereits tickende Zeitbombe war, deren Ticker stetig an Geschwindigkeit und Gefährlichkeit zunimmt.
Für seine Gefühle hat der Täter keine Sprache. Diese Sprachlosigkeit – in der Regel hat auch das Umfeld keine Sprache - ist anlässlich eines tiefen Maßes an Kränkung und Entwertung entstanden. Die Rache für den zugefügten Schmerz ist die Ausdrucksform oder Sprache des Täters.
An diesem Punkt kommen auch wieder die allgemeine gesellschaftliche Verfassung und Lebenswirklichkeit ins Spiel, die letztlich mit ihren zeitgeistgeprägten Parametern, ihrer Verdrängungen und ihren Rationalisierungen den Nährboden für Exzesse überhaupt schaffen bzw. herausbilden lassen.
Subtile, grobe, laute, stille, mediale, virtuelle, ge- bzw. erträumte, physische, psychische, sexuelle, familiäre, gruppengemäße, politische und wirtschaftliche Gewalt, Rücksichtslosigkeit, Ellenbogendenken und Machtmissbrauch an allen Ecken und Enden der Gesellschaft sind die sogenannte Normalität, in der sich das Leben der Menschen bewegt.
Im Zusammenhang mit der Omnipräsenz der Gewalt muss die Frage gestellt werden, wie viel Gewalt – und hier ist nicht einzig direkte, ausgeübte und erlittene (physische, psychische und verbale), hingegen ebenfalls indirekte (im näheren Umfeld sich ereignende), medial konsumierte Gewalt gemeint – eine normale, gesunde Sozialisation eines Kindes verträgt respektive wie viel an diesbezüglicher Widersprüchlichkeit (einerseits die gesellschaftliche Verurteilung von Gewalt und andererseits deren permanente Präsenz).
Für Erwachsene ist Gewalt in jeder ihrer Ausdrucksformen zur täglichen Realität geworden und diese Normalität wird betreffend der Zumutbarkeit für die kindliche Psyche und deren Verarbeitungsmöglichkeiten deshalb entweder gar nicht oder bloß unzureichend berücksichtigt.
Wie soll ein Kind Gewalt verstehen, einordnen und damit umgehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Gewalt immer eine Verletzung der psychischen Grundbedürfnisse darstellt? Wie ist einem Kind zu erklären, warum da gemordet und dort vergewaltigt wird?
Unter dem Aspekt, dass Gewalt grundsätzlich sowohl die Psyche berührt, wie Ausdruck einer psychischen Problematik ist, sind korrespondierende Verdrängungsreaktionen des Kindes mit ungewissen Auswirkungen und Ergebnis unausbleiblich.
Eine Zwischenbemerkung, die einerseits die Problematik im öffentlichen Umgang mit Gewalt veranschaulicht, andererseits aber auch aufzeigt, wie wenig – tiefere - Ahnung die Fachleute bezüglich der elementaren psychischen Zusammenhänge, gerade Kinder und Jugendliche betreffend, haben. Auf die Frage, ob Jugendlichen alles an Gewalt medial zuzumuten ist, antwortete eine Psychologin mit „grundsätzlich ja, denn sonst sind wir wieder bei der Bevormundung. Wer bestimmt denn darüber, was dem Einzelnen zumutbar ist? Schule wie Eltern sollen den Jugendlichen befähigen, mit dem umzugehen, was ihm in der Realität begegnet.“
Wenn beispielsweise Gewaltspiele so weit verbreitet und demnach beliebt sind, dann sagt dies sehr viel über den wirklichen Zustand einer Gesellschaft aus.
Woher entspringt die entsprechend große Affinität und weshalb kann die Gesellschaft keine selbstkritischen Rückschlüsse hinsichtlich dieser Thematik ziehen?
Es gibt ein dermaßen umfangreiches Angebot an Gewalt in ihrer unterschiedlichsten Ausprägung und dies, weil offensichtlich eine genauso große Nachfrage und Begierde danach existiert. Wenn es diese Nachfrage und den Bedarf nicht gäbe, dann wäre die Gewalt nicht solchem Grade allgegenwärtig und deren Angebot und Gegenwart würden sich nachhaltig reduzieren. Tatsächlich kann konstatiert werden, je mehr Gewalt, desto mehr (öffentliches) Interesse, desto besser die Vermarktungschancen.
Diese Nachfrage beruht auf einem starken Interesse und auch einer häufig beachtlichen Faszination, die kraft eines sehr intensiven Bedürfnisses hervorgerufen werden. Das Verlangen begründet sich in der Notwendigkeit für Ersatzhandlungen mit angemessenem Ersatzbefriedigungscharakter, die mit und dank des Konsums und der Ausübung von Gewalt besonders leicht erreicht werden können.
Gerade Gewalt mit ihren in Verbindung stehenden Attributen und Wesenszügen (u. a. Stärke, Größe, Bedeutung, Geltung, Kontrolle, Entscheidungsmacht), die der Antipode (im Sinne von Gegenpart/-seite) zu den Eigenschaften eines Defizits (u. a. Schwäche, Abhängigkeit, Ohnmacht, Handlungsunfähigkeit) ausmachen, ist prädestiniert zur schnellen Generierung von Ersatzbefriedigung und daher ein geeignetes Kompensationsmedium.
Читать дальше