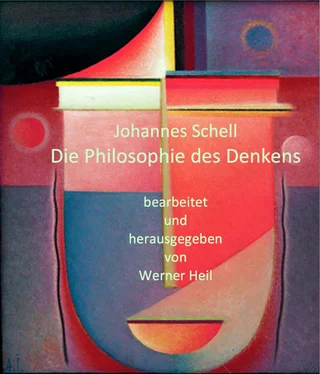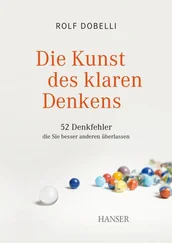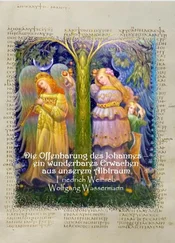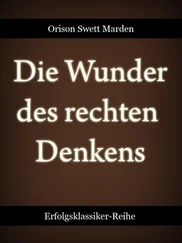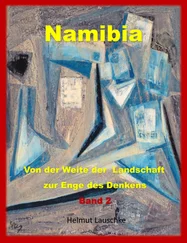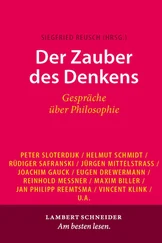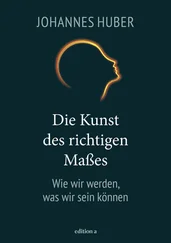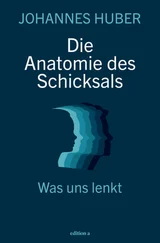Damit haben wir auch die praktische Seite dessen, was wir Denkbeobachtung nennen, andeutungsweise miterwähnt. Aus allen diesen Überlegungen und Schilderungen wird ersichtlich, dass es keinen gleichförmig-linearen Entwicklungsgang gibt. Alle organisierten Werdeprozesse, die der Mensch in sich selbst und in seinen Schöpfungen in Gang setzt, verlaufen intermittierend, d.h. in rhythmischen Unterbrechungen, von Pol zu Pol, vom Beobachten zum Gegenüberstellen, von der Enträumlichung zur Verräumlichung, von der „Zusammenziehung“ zur „Ausdehnung“, von der „Involution“ zur „Evolution“ - und wieder zurück. Dem Deutschen Idealismus waren diese Phänomene bekannt, ganz besonders dem großen Philosophen Hegel, der sie in mystisch logifizierender Weise in eine objektive Weltdialektik verwandelt hat. Aber nirgends lässt sich eine „Selbstbewegung der Begriffe“ wahrnehmen. Der Fall liegt so, wie wir ihn beschrieben haben: es ist einzig der Mensch, der seine Begriffe erzeugt und bewegt, und zwar in der angegeben Weise.
Wir wollen diesen Prozess des menschlichen Geistes die „intermittierende Denkbeobachtung“ nennen und versuchen, sie nach und nach genauer kennenzulernen. Sie werden auch immer besser begreifen, warum wir den Begriff „Philosophie der Denkakte“ verwenden.
11. Das bestimmungslose Denken und seine Kogitate
Natürlich werden Sie sich mit diesen Ausführungen nicht zufrieden geben und eine weitergreifende Darstellung dessen, was wir das „Denken“ nennen, erwarten. Dazu bedarf es der Hereinnahme eines neuen Begriffs.
Dazu bedarf es noch einmal einer kurzen Betrachtung dessen, was wir die „Kogitate“ genannt hatten. Nach unseren bisherigen Überlegungen sind Kogitate nichts anderes als die Resultate des Denkprozesses, die sich, so hatten wir (metaphorisch) festgestellt, auf einer psychischen „Bildwand“ eingravieren und dort wie Erinnerungen und Vorstellungen beobachtet und abgelesen werden können. Das ist natürlich eine Vereinfachung, die wir gleich korrigieren werden, aber an der Tatsache des Übergangs vom unbewusst ablaufenden Denkprozess bis hin zur bewussten Gegenüberstellung lässt sich nicht rütteln, auch wenn wir die konkreten Abläufe nicht analysieren können. Wir beschäftigen uns mit unseren Gedanken und Begriffen wie mit allen anderen Wahrnehmungen, wie mit Objekten der Außenwelt, auch wenn es uns unüberwindliche Schwierigkeiten macht, ihre substantielle Existenzform zu bestimmen. Ob wir nun „Nominalisten“ oder „Realisten“ sind, ob wir von „Fiktionen“ oder „Realwesen“ reden - sie besitzen immer die Gestalt des Gegenüber, mit dem wir uns als einer unabweisbaren Erscheinungsform unserer Welt auseinandersetzen müssen, auch dann, wenn nichts da ist, was wir mit Händen greifen können. Die Schwierigkeiten liegen in der Tatsache, dass wir, wie es den Anschein hat, gar nicht in der Lage sind, einen Begriff oder Gedanken ohne die Mitwirkung einer psychischen Vorstellung zu bilden. Daher kommen ja die diversen Ansichten von der angeblichen Identität der Vorstellungen mit den Begriffen und als Folge davon die zunehmende Bereitwilligkeit, dem Denken jede Realität abzusprechen. Schon der Begriff „Abstraktion“ suggeriert eine Philosophie des fiktionalistischen Theoretisierens, obwohl jeder Mensch weiß, dass unsere Begriffe etwas mit der realen Welt zu tun haben müssen, sonst wäre dem Menschen keine sinnvolle Orientierung in seiner Umwelt möglich. Auch kann der Begriff der „Fiktion“ nicht in sich selbst fiktiv sein, oder man hebt das Denken auf. Bei Rudolf Steiner lesen wir:
„Durch das Denken entstehen Begriffe und Ideen. Was ein Begriff ist, kann mit Worten nicht gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. Dornach 15. Auflage 1987, S. 57)
Wir gehen also mit einem Etwas um, von dem wir nur wissen, dass es in uns entsteht; und vielleicht sagt uns dieser Entstehungsprozess etwas mehr über das Denken aus, als es die einzelnen Begriffe können. Begriffe sind nicht einfach da: sie werden hervorgebracht. Diese Tätigkeit des Hervorbringens, so haben wir bereits endgültig festgestellt, lässt sich aber nicht beobachten. Damit fallen wir in ein Fass ohne Boden, das für alle Spekulationen offensteht. Was geschieht in diesem Abgrund des Unbewussten? Sind es geheime Führungen, die uns eine Fata Morgana der Freiheit vorgaukeln, vielleicht sogar nur Reflexe von sog. „Gehirnprozessen“, wie uns der positivistische Zeitgeist einreden möchte, oder geschehen höhere Dinge in Form von „Eingebungen“, „Inspirationen“ und dergleichen? Keine dieser Annahmen ist berechtigt. Gehirnprozesse und Inspirationen erklären sich nicht aus sich selbst: sie sind, sofern wir uns ihrer bewusst werden, bereits Gedachtes, sind produzierte Kogitate, enthalten also, wie wir später genau analysieren wollen, das Element des Ideellen, ohne das es keine Erkenntnis gibt. Dasselbe gilt für alle metaphysischen Konstruktionen, in denen die Begriffe ohne Wahrnehmungsgrundlage mit sich selber spielen. Wir besitzen also, nach dem jetzigen Stand der Dinge, nichts, um den Abgrund der Denktätigkeit, von der wir gesprochen haben, mit greifbaren Erfahrungsinhalten zu besetzen. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Der kausalistische Ableitungsgedanke stößt irgendwann einmal auf seine methodologischen Grenzen, oder er siecht im unendlichen Regress dahin. Es gibt logischerweise nichts vor dem Denken als das Denken selbst. Wie wir uns auch anstellen mögen, wir kommen aus dem Denken niemals heraus, ebenso wenig wie aus der Wahrnehmungswelt, ohne die wir überhaupt nicht denken könnten. Damit klärt sich ein wichtiges Verhältnis zwischen Begriff und Wahrnehmung in rein formaler Hinsicht. Den ontologischen Aspekt lassen wir noch beiseite. Begriffe beziehen sich immer und ausnahmslos auf das Besondere, auf das Individuelle, auf spezifische Objekte, die sich voneinander unterscheiden, wobei es völlig gleichgültig ist, wo und wie sie als Gegenüberstehendes auftreten, ob als Begriffe, Gedanken, Formeln, ob als Stimmungen, Gefühle und Triebe oder als raumzeitliche Gegenstände der materiellen Umwelt. Mit Hilfe des Begriffs treffen wir unsere Unterscheidungen, um ein Objekt als dieses und kein anderes identifizieren zu können. Und wenn wir ideelle Relationen (Synthesen aller Art) herstellen, dann stehen wir wieder in ganz individuellen Bezügen, die nur im jeweiligen Fall gültig sind. Daran ändert auch der „allgemeine“ Charakter der Begriffe nichts: jeder Allgemeinbegriff - und das sind alle außer den Namen - hat immer einen konkret-spezifischen Bezug auf ein Vorgegebenes, auch im Sonderfall der „selbstproduzierten Wahrnehmung“, und seien es „nur“ die subtilsten mathematischen Kogitate, die wir uns „vorstellen“ oder sogar niederschreiben, um das Gegenüber mit materiellen Mitteln zu stützen. Kogitate „an sich“, ohne spezifischen Realbezug, gibt es nirgends. Damit erschließt sich die „Denktätigkeit“ als die Produktionsstätte von ideellen Einzelgeschöpfen, deren individueller Charakter niemals aufgehoben werden kann - mit anderen Worten: das Denken ist kein Vorgang wie alle anderen, es nimmt eine ausgezeichnete, d.h. einmalige Stellung ein, die sich vorläufig nur als Negativum fassen lässt: Das Denken zeigt keine inhärenten Strukturen. Es ist unbestimmt.
Natürlich meint der Begriff „unbestimmt“ etwas anderes als die immer wieder schwer überwindbare Unklarheit oder Ungenauigkeit des menschlichen Denkens. Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, wollen wir vom „bestimmungslosen Denken“ sprechen und damit eindeutig ausdrücken, was gemeint ist: die Strukturlosigkeit des Denkelementes, das die Begriffe produziert, also jener Tätigkeit, die wir von ihren Resultaten unterscheiden mussten. Wir entdecken keinen Vorratskasten, in dem Begriffe, Kategorien oder Prinzipien aufbewahrt sind, um bei Gelegenheit zum Vorschein zu kommen, sondern das genaue Gegenteil: ein Etwas, das die Fähigkeit besitzt, spezifische begriffliche Bestimmungen hervorzubringen, die zur Welt gehören, aber nicht unmittelbar aus den Wahrnehmungen hervorgehen. Diese Begriffsbildung richtet sich nach den Objekten, die uns gegenübertreten, und holt heraus, was sie unterscheidet und verbindet. Das ist auch der Grund dafür, dass wir die ideelle Ordnung der Dinge als objektive Weltordnung begreifen. Aber es ist nun einmal Tatsache, dass wir uns selbst als die Produzenten der Begriffe fühlen und deshalb Gefahr laufen, alles Begriffliche zum Denkinhalt zu machen oder zu Objekten zu stilisieren, die von der Erfahrungswelt grundsätzlich verschieden sind. Die berühmte Kategorientafel Kants ist ein herausragendes Beispiel für diese Auffassung, die sich gegen den Empirismus Humes wendet. Die Erfahrung bietet nichts an, was innere Notwendigkeit aufweist. Nur die sog. kategorialen Begriffe enthalten ein Element, das allem entgegensteht, was Innen- und Außenwelt zu bieten haben, die unableitbare „Denknotwendigkeit“, mit der Kant seine Erkenntnislehre begründet. Wir werden sehen, dass darin ein interessanter Trugschluss verborgen liegt, der daher kommt, dass die Kategorien aus ihrem Zusammenhang herausgehoben und als Denkbestimmungen behandelt wurden. In Wahrheit unterscheiden sich diese Kategorien in nichts von den anderen Begriffen: sie alle sind Bestimmungen, die zur Wahrnehmungswelt gehören. Und sie werden von einem tätigen Denken produziert, das über jede einzelne Bestimmung hinaus ist, sonst wäre es unfähig, Bestimmungen hervorzubringen. Nur ein Unbestimmtes kann Bestimmtes erkennen. In dem Augenblick, wo wir dem Denken eine bestimmte Struktur zuweisen, stellen wir es in eine Reihe mit allen strukturierten Wahrnehmungen und stehen vor dem unlöslichen Problem, wie es möglich sein soll, dass eine Struktur die andere erkennen soll. Kant hat sich Begriffe gegenübergestellt, die eine führende Rolle im Denken spielen, war aber nicht in der Lage, den Grund hierfür anzugeben. Er nahm sie als endgültige Strukturen des Denkens, nach denen sich die Erfahrung zu richten hat. So wird die Welt zum Spiegel einer überpersönlichen Denkstruktur, für deren Annahme keine Veranlassung vorliegt, wenn man sich die Mühe macht, von Beobachtungen auszugehen. Auch Hegel klammert sich an Begriffe, allerdings mit dem Unterschied, dass er sie „in Bewegung“ bringen will, um ihre gegenseitigen Beziehungen aufzudecken. Beiden Philosophen fehlt der Blick auf das bestimmungslose Denken, das über allen Begriffen steht, die nur spezifische Resultate seiner Arbeit sind. Kant sieht es überhaupt nicht, und Hegel, der es erlebt, setzt es kurzerhand als ontologisches Urprinzip, als sog. „Weltgeist“ an, der sich an seinen eigenen Begriffsstrukturen entwickelt und damit, entgegen allen Versicherungen, die Menschen in Begriffe verwandelt, wie seine mystifizierende Logik eindeutig beweist. Wir können hier schon feststellen: es gibt kein dialektisches Denken, auch wenn wir zweifellos polarisierte und korrelative Begriffe handhaben müssen. Dialektische Bewegungen gehören - und hier war Karl Marx im Recht - der Erfahrungswelt an, werden begrifflich erfasst, d.h. erkannt und von unserem Ich in Freiheit „bewegt“. Kein Weltgeist dirigiert uns. Wenn das Denken selbst dialektisch wäre, könnte es immer nur die jeweilige Position oder Gegenposition beziehen und müsste ganz und bewusstlos in ihr aufgehen und automatisch weitere Positionen hervorbringen, ohne irgend etwas davon zu wissen. Schon die Tatsache, dass Hegel von „Dialektik“ spricht, zeigt das wahre Verhältnis des bestimmungslosen Denkens zu seinen Begriffen: es ist sozusagen neutral, es steht über allen seinen Produkten, es ist in diesem Sinne weder logisch noch alogisch, auch nicht dialektisch, sondern überlogisch und universell. Es wäre allerdings unzulässig, von einem „Metadenken“ zu reden, weil das bestimmungslose Denken und die Produktion von Begriffen doch nur so verstanden werden können, dass sie unmittelbar ineinandergreifen, d.h. dass sie zwei Aspekte eines Geburtsvorgangs sind, die wir nur begrifflich auseinanderhalten dürfen, während sie realiter als höhere Einheit gelten müssen - auch wenn sich dieser Prozess aus naheliegenden Gründen nicht mehr analysieren lässt. Aber wir werden noch manches hinzufügen können.
Читать дальше