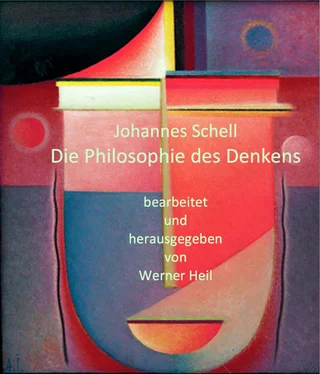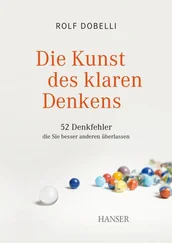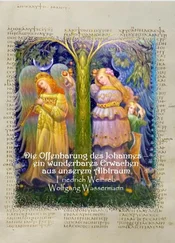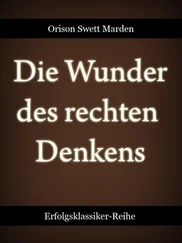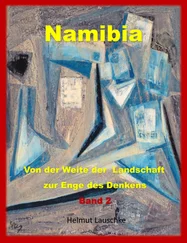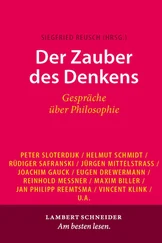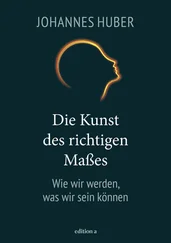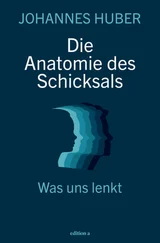Damit erhellt sich die ursprüngliche Polarität des menschlichen Bewusstseins. Auf der einen Seite steht die „Ich-Organisation“, wie wir von jetzt an das Zusammenspiel von Willenszentrum, Beobachtung und Denktätigkeit nennen wollen, auf der andern Seite steht die Fülle der vorgegebenen Wahrnehmungen, innen und außen, einschließlich des Sonderfalls der „selbstproduzierten Wahrnehmungen“, also der fertigen Begriffe, die uns gegenübertreten. Im Zentrum der Ich-Organisation befindet sich das, was wir unser „Ich“ nennen - und dieses Ich ist der eigentliche Mittelpunkt der ersten Seite der Polarität und kann Ich-Pol genannt werden, wenn wir das folgende berücksichtigen. Das Ich hebt sich aus der Ich-Organisation deshalb heraus, weil es sein eigenes Verhalten in Begriffe fasst und damit objektiviert. Auf diese Weise steht es den Phänomenen, die wir beschrieben haben, in einer (bald näher zu bestimmenden) aktiven Freiheit gegenüber und geht mit seinem aktologischen Umfeld immer wechselnde Verbindungen ein, die einem gewissen Rhythmus unterliegen, d.h. die scheinbar statische Polarität von Ich und Gegenüberstellung aktualisiert sich im konkreten Prozess der Denkbeobachtung, die wir zum methodologischen Ausgangspunkt gemacht hatten. Beide Phänomen erhellen sich gegenseitig und verweben sich zu einem Aktgefüge, das wir handhaben können. Wir dürfen jetzt diesen Sachverhalt auch einmal ganz simpel aussprechen, ohne missverstanden zu werden: das Ich bemächtigt sich denkend seiner Wahrnehmungsobjekte, setzt sich tätig mit ihnen auseinander und findet die bereits erwähnte geistige „Befriedigung“, wenn es ihm gelingt, eine ideelle Ordnung herzustellen, die etwas von dem hat, was als Wahrheit gilt. Und noch einmal anders: Denken ist immer Handeln, ja sogar die Urform des Handelns, von der feinsten Begriffsbildung bis zur schlichtesten praktischen Tätigkeit in allen ihren Formen, in allen möglichen materiellen Vermittlungen. Denken ist Arbeit.
Wie sieht nun diese aktologische Arbeit aus? Um das festzustellen, brauche ich mich nur auf Ihre täglichen Erfahrungen zu berufen, die sie alle machen, auch wenn Sie sich ihrer nicht immer bewusst werden. Ich bin sicher, Sie haben den lebendigen Pendelschlag Ihres Bewusstseins, das tätige Hin und Her zwischen Ich und Umwelt, die rhythmischen Übergänge von dem einen zum andern zuweilen so intensiv erfahren, dass Sie deutlich gewahr wurden, was in Ihnen vorgeht. Ich sage Ihnen also nichts Neues. Aber die Frage ist, ob Sie bereits die ganze Bedeutung dieser Vorgänge eingesehen haben. Wir werden sie im Laufe der Zeit noch genauer kennenlernen. Heute beschränken wir uns auf einen grundlegenden Zusammenhang, den wir hier bereits brauchen. Wenn das Ich beobachtend tätig wird, entfaltet es eine einzigartige Hingabefähigkeit, die weitreichende Konsequenzen hat. Es tritt etwas ein, was schwer zu begreifen ist und kaum untersucht wird: das Ich verliert sich in seinem Objekt, das es erkennend ergreifen will, und zwar bis zur Selbstaufgabe, bis zur „Selbstvergessenheit“, wie wir richtig sagen. Es verliert, bis zu einem gewissen Grade, sein Selbstbewusstsein, seine Identifikation, weil es sich mit dem Wahrnehmungsobjekt vorübergehend identifiziert. Diese Auslöschung des Selbstes hat Rudolf Steiner immer wieder, in vielfachen Zusammenhängen, nicht zu Unrecht mit dem Phänomen des Einschlafens verglichen, allerdings mit dem Unterschied, dass natürlich das Bewusstsein nicht völlig erlischt. Aber dieser Zustand ist so ausgeprägt, wenn auch nur für kurze Momente, dass eine radikale „Selbstvergessenheit“ eintritt, von der wir uns ganz selten Rechenschaft abgeben. Wir verlieren uns nahezu völlig, aber ohne irgendein Angstgefühl, das uns zurückholen möchte. Jedenfalls wissen wir nichts davon. Der etwas rätselhafte Umschwung, das „Erwachen“, kommt ganz plötzlich und wie von selbst. Mit einer nur selten kontrollierbaren Automatik schwingt das Pendel in die Ausgangslage zurück, d.h. auf die Gegenseite, zum Ich-Pol der Selbsterinnerung, zum Selbstbewusstsein - aber auch das nur einen kurzen, kaum messbaren Augenblick lang, um sich sofort wieder demselben Objekt oder einem anderen zuzuwenden, je nach Erkenntnisbedürfnis. Wie lange auch die Wiederholungen dieses Aktes, die der Begriffsbildung dienen, währen mögen, sie unterliegen einem übergeordneten Rhythmus: von Zeit zu Zeit findet eine nahezu vollständige Zurücknahme des Ichs statt, eine Abwendung von allen Einzelobjekten und Tätigkeiten, um das Gesamtresultat der bisher geleisteten Arbeit zu begutachten. Der Schöpfer betrachtet sein Werk als Ganzes. Das Gesamtresultat wird jetzt zum Objekt der denkenden Betrachtung, das Neue: die „selbstproduzierte Wahrnehmung“ stellt sich als frisch hinzugekommenes Erfahrungselement dem Denken zur weiteren Bearbeitung. Mit sich allein könnte das Ich nichts anfangen. Das Pendel muss wieder ausschlagen, aber diesmal mit der Absicht, die Gesamtsituation zu erfassen, in der sich das Ich während seiner Tätigkeit befunden hatte. Wenn wir nun voraussetzen, dass die getane Arbeit erfolgreich war, dass sich neue Begriffe gebildet haben, die zu den Objekten passen, dann wird die Ich-Organisation eine mehr oder minder bedeutsame Verwandlung feststellen: der Begriffshorizont hat sich genau um soviel Begriffe vermehrt, wie entdeckt worden sind. Eine kaum spürbare Verwandlung der Gesamtsituation hat stattgefunden. Die erste Objektbetrachtung geschah mit Hilfe der bereits vorhandenen Begriffssphäre, also aus dem Bereich, den wir manchmal „Vorinterpretation“ nennen, die zugleich ein „Vorverständnis“ ist. Nach der Totalzurücknahme findet sich die Begriffssphäre um die erworbenen Begriffe bereichert vor - und macht sehr schnell die Erfahrung, dass nun neue Möglichkeiten von Begriffsrelationen auftauchen, von denen sie vorher nichts wissen konnte. Das kann unter Umständen sogar von großer wissenschaftlicher Bedeutung sein. Aber bleiben wir bei den kleineren Resultaten. Wenn nun der denkende Betrachter seine Gesamtzurücknahme aufgibt und sich dem verlassenen Werk zuwendet, dann tut er das mit einem neuen Verständnis, das er sich durch seine Arbeit erworben hat. Er ist, wenn auch in noch so geringem Grade, wissender geworden und, wenn es hochkommt, auch um einen Schritt reifer und weiser. Er wird Erkenntnisse erlangen, die ihm bisher verschlossen waren, und damit seine Begriffssphäre noch einmal bereichern - und so weiter. An einem praktischen Beispiel lässt sich dieser Vorgang am besten illustrieren.
Nehmen Sie einen Handwerker, der sich selbst eine Maschine bauen möchte, die er auf dem Markt noch nicht auftreiben konnte, weil sie noch nicht erfunden wurde. Er wird sich zuerst gewisse brauchbare ideelle Vorstellungen machen, dann einen Werkplan entwerfen und schließlich an die Arbeit gehen. Weil er Neuland betritt, ist er sich des Risikos, das er eingeht, durchaus bewusst. Er vertieft sich in jede Einzelheit, experimentiert mit Material und Begriffsverbindungen und probt einige praktische Konstruktionen so lange durch, bis er am Ende des ersten Arbeitstages das angefangene Werk betrachtet und begutachtet. Er muss feststellen, dass ihm nicht alles so gelungen ist, wie er gehofft hatte - d.h. er entdeckt Zusammenhänge und Möglichkeiten der Konstruktion, die das Ergebnis einer fortschreitenden Begriffsbildung während der Arbeit waren. Nun vollzieht er eine „Totalzurücknahme“, setzt sein Denken mit neu erworbenen Begriffen in Bewegung, entdeckt bessere Konstruktionsmöglichkeiten und tut am nächsten Morgen, so wollen wir annehmen, den radikalsten Schritt, den es geben kann: er beginnt noch einmal ganz von vorn. Das Werkstück von gestern stellt er in irgendeine Ecke, damit es aus dem Weg ist.
Mit der Zeit werden sich in dieser Ecke unfertige oder fertige, aber unvollkommene Werkstücke ansammeln, die man in chronologischer Reihenfolge aneinanderreihen könnte, um ein genaues Anschauungsbild der Entwicklung bis zum endgültigen Produkt zu erhalten. Und ein solches Anschauungsmaterial gibt es tatsächlich, vor allem für die Erzeugnisse großer Firmen. Und wenn Sie diese Bilderfolgen gerne genießen wollen, dann betrachten Sie einmal sorgfältig die internen historischen Werksberichte oder die öffentlichen Prospekte über die Entwicklung z.B. des Fahrrads, des Automobils, des Computers oder der Betriebsmaschinen, und Sie werden eine Reihenfolge von Bildern finden, die als Vorstufen des Endproduktes eine ausdrucksvolle Sprache sprechen; beim Automobil etwa vom Postkutschengefährt bis zum modernen windgeschnittenen, rasanten Fahrzeug, in das die begriffliche Arbeit von Jahrzehnten eingegangen ist, und zwar mit allem Drum und Dran, angefangen mit den simpelsten physikochemischen Überlegungen, über den mehrfach geprüften Einbau verschiedenster Materialien auf genau berechneter ökonomischer Basis, des weiteren über die optimalen Anpassungsformen an alles und jedes - bis hin zum bestausgeklügelten Optimum des Endproduktes, in dem alle Umweltfaktoren, Naturgesetze und Stoffe sachgerecht und rationell ineinandergreifen. Das ist der langwierige Weg, auf dem sich die erste Vorstellung des geplanten Werkstücks so präzise wie möglich verwirklicht. Machen Sie sich die Mühe, einen solchen scheinbar harmlosen, historisierenden Bilderbogen in Augenschein zu nehmen, und Sie werden erkennen, wie sich der Rhythmus der Denkbeobachtung in sichtbaren Erscheinungen vor Ihnen abspielt. Jede Veränderung in den einzelnen Bildern offenbart die Begriffsbildung, die kleinen Zurücknahmen des Ichs und die immer neuen Zuwendungen zu den Objekten der Erkenntnis und Gestaltung. Und die Leerräume zwischen den einzelnen Bildern markieren die großen Totalzurücknahmen, die produktiven Gesamtunterbrechungen, also jene Vorgänge, die sich innerhalb des Geistes der Ingenieure abspielen und nicht unmittelbar in die visuelle Sichtbarkeit des konkreten Werkstücks übergehen können. Nur die herausdestillierten Resultate werden sichtbar. Natürlich greifen alle diese Prozesse tausendfach ineinander, aber immer nach demselben Grundmuster: als Spiel und Widerspiel der Denkbeobachtung. In der Bilderfolge der Produkte präsentiert sich ein Entwicklungsablauf, der sich in konzentrischen Stufen vollzieht, zwischen denen die Nullpunkte der Selbstbesinnung, der Pendelschläge zum Ich-Pol liegen, mit denen die neue Arbeit in der erweiterten Begriffssphäre ihren Anfang vorbereitet, deren Ergebnisse erst später ihren Niederschlag im Werkstück finden. Dieser Nullpunkt ist wichtig und wird uns später noch ausführlich beschäftigen.
Читать дальше