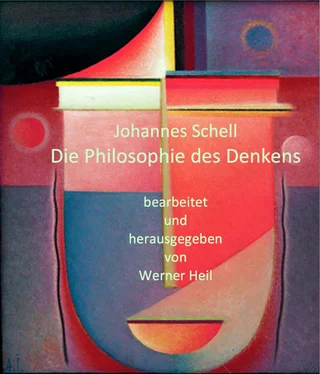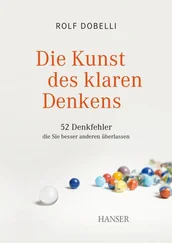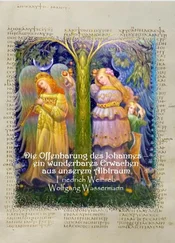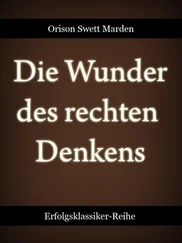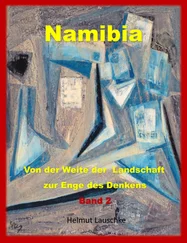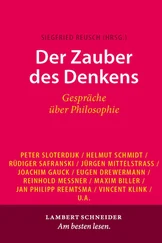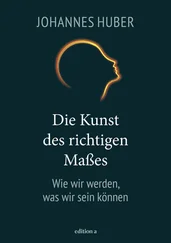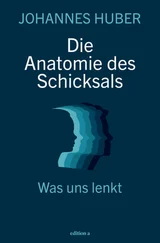1 ...8 9 10 12 13 14 ...28
C. DIE INTERMITTIERENDE „DENKBEOBACHTUNG“ ALS URSPRÜNGLICHE BEWUSSTSEINSPOLARITÄT
8. Das methodologische Urphänomen der Wissenschaft und Philosophie
Uns liegen nun fünf erste Beobachtungen vor: (1) Worauf wir im täglichen Denken niemals reflektieren, ist das Denken selbst - wir übersehen es; (2) wir streben im Erkennen der Welt immer und ausschließlich nach „Einheit“, weil wir nur eine einheitliche Welt begreifen können; (3) unter allen Prozessen der Welt ist das Denken der einzige, bei dem wir dabei sein müssen, wenn er ablaufen soll; (4) Mit der Produktion von Begriffen tauchen wir ins lebensnotwendige Element dessen ein, was wir Wahrheit nennen; (5) die selbstproduzierten Begriffe dieser Wahrheitswelt stehen in dauernder Wechselwirkung mit allen Wahrnehmungen, die ohne unser Zutun vorhanden sind. Aus diesen Beobachtungen haben wir geschlossen, dass zuerst die geistig ordnende Macht, also das Denken, untersucht werden muss, sofern das überhaupt möglich ist.
In diesen „Kristallisationspunkten“ versteckt sich aber eine Fülle von Zusammenhängen, deren Struktur noch ungeklärt ist. Bevor wir uns dem Denken zuwenden, müssen wir konkrete Beziehungen aufdecken, die wir etwas großzügig überspielt haben. Schon das Doppelphänomen von Begriffsschöpfung und fertigem Begriff, von tätigem Hervorbringen und Hervorgebrachtem, von Akt und Resultat kann Verwirrung stiften. Mit der Bezeichnung „Selbstproduziertes“ für die ideelle Seite, also das erste Phänomen, kommen wir nicht durch, oder wir müssten diesen Vorgang zugleich vollziehen und beobachten können. Das scheint unmöglich zu sein. Was geschieht wirklich? Zunächst ist festzustellen: unser Denken erzeugt nur dann seine Begriffe, wenn ihm in irgendeiner Weise eine konkrete Wahrnehmung entgegentritt, also ein Objekt, das sozusagen von außen kommt oder so erscheint, sei es uns vorgegeben. Worüber wir auch Begriffe bilden mögen, zuerst muss uns eine Wahrnehmung gegenübertreten, an der sich das Denken entzündet, um einen passenden Begriff zu erzeugen. Ohne Anstoß von „außen“ würde es in ewiger Ruhe verharren, also niemals aktiv werden, d.h. wir könnten von seiner Existenz nichts erfahren. Ohne dieses vorgegebene Widerlager, worauf ja der Begriff „Wahrnehmung“ (in immer noch unklarer Weise) zielt, wird unser Denken nicht tätig. Und wenn es tätig wird, produziert es etwas, das wie jede andere Wahrnehmung vor uns steht, wie ein Gegenstand, der sich nur darin von so vielen anderen unterscheidet, dass wir selbst seine Erzeuger sind. Und wir müssen uns dem so plötzlich Erscheinenden gegenüberstellen, können unsere Aufmerksamkeit darauf richten und darüber nachdenken, was es mit diesem „Objekt“ auf sich hat, das in so „fragwürdiger Gestalt“ wie der Geist im „Hamlet“ vor uns hintritt. Aber wie wir uns auch verhalten, wie lange wir auch beobachten und rätseln: dieser persönliche Willensvorgang fügt nichts Neues zu den beiden Grundelementen des Bewusstseins hinzu, „Begriff“ und „Wahrnehmung“ in ihrer charakteristischen Existenz bleiben unangetastet. Wir umkreisen diese beiden Phänomene, um neue dazugehörige Begriffe zu bilden. Es gibt keine andere Möglichkeit: der Blitz des Gedanken entzündet sich am Widerlager der „Wahrnehmung“, wobei es völlig gleichgültig ist, ob es sich um „innere“ oder „äußere“ Wahrnehmungen handelt, d.h. wir bewegen uns immer in konkreten „Gegenüberstellungen“, deren Entstehungsweise zunächst keine Rolle zu spielen braucht. Begriffe wie „Wahrnehmungsakt“, „Vorstellung“, „Schein“ und „Erscheinung“ sind bereits Resultate langer theoretischer Überlegungen und haben hier noch gar nichts zu suchen. Wir wissen überhaupt noch nicht, in welchem Zusammenhang unser Doppelphänomen mit uns und anderen Welttatsachen steht. Wir bewegen uns ausschließlich in Gegenüberstellungen, die sich, wie wir wissen, miteinander verbinden, ohne uns zu verraten, wie diese Verbindung zustande kommt und welches endgültige Ziel sie verfolgt.
Eins aber ist gewiss: wenn uns Objekte, also Phänomene der Gegenüberstellung, als sog. „Widerlager“ entgegentreten, dann müssen wir sie mit den Kräften der Aufmerksamkeit beobachten, um Begriffe zu bilden, d.h. wir müssen beobachten und denken. Zur bereits vorhandenen Wahrnehmung, wie sie auch entstanden sein mag, produzieren wir das begriffliche Element, das wir als Komplettierung der Wahrnehmung empfinden - und zwar ohne Rücksicht darauf, ob uns materielle, psychische oder mentale „Gegenstände“ (physische Raumgestalten, Gefühle oder Begriffe und Gedanken) entgegentreten. Für die materielle Seite hat Rudolf Steiner am Beispiel des Billardspiels dieses Verhältnis klar zu machen versucht. Er schreibt:
„Wenn ich beobachte, wie eine Billardkugel, die gestoßen wird, ihre Bewegung auf eine andere überträgt, so bleibe ich auf den Verlauf dieses beobachteten Vorganges ganz ohne Einfluss. Die Bewegungsrichtung und Schnelligkeit der zweiten Kugel ist durch die Richtung und Schnelligkeit der ersten bestimmt. Solange ich mich bloß als Beobachter verhalte, weiß ich über die Bewegung der zweiten Kugel erst dann etwas zu sagen, wenn dieselbe eingetreten ist. Anders ist die Sache, wenn ich über den Inhalt meiner Beobachtung nachzudenken beginne. Mein Nachdenken hat den Zweck, von dem Vorgange Begriffe zu bilden. Ich bringe den Begriff einer elastischen Kugel in Verbindung mit gewissen anderen Begriffen der Mechanik und ziehe die besonderen Umstände in Erwägung, die in dem vorkommenden Falle obwalten. Ich suche also zu dem Vorgange, der sich ohne mein Zutun abspielt, einen zweiten hinzuzufügen, der sich in der begrifflichen Sphäre vollzieht. Der letztere ist von mir abhängig. Das zeigt sich dadurch, dass ich mich mit der Beobachtung begnügen und auf alles Begriffesuchen verzichten kann, wenn ich kein Bedürfnis danach habe. Wenn dieses Bedürfnis aber vorhanden ist, dann beruhige ich mich erst, wenn ich die Begriffe: Kugel, Stoß, Geschwindigkeit usw. in eine gewisse Verbindung gebracht habe, zu welcher der beobachtete Vorgang in einem bestimmten Verhältnisse steht. So gewiss nun ist, dass sich der Vorgang unabhängig von mir vollzieht, so gewiss ist es, dass sich der begriffliche Prozess ohne mein Zutun nicht abspielen kann.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 36)
Er fährt dann vorläufig einschränkend fort:
„Ob dieses Tun in Wahrheit unser Tun ist oder ob wir es einer unabänderlichen Notwendigkeit gemäß vollziehen, lassen wir vorläufig dahingestellt.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 37)
Daraus ergeben sich die Konsequenzen von selbst:
„Beim Zustandekommen der Welterscheinungen mag das Denken eine Nebenrolle spielen, beim Zustandekommen einer Ansicht darüber kommt ihm aber sicher eine Hauptrolle zu.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 39)
Diese Überlegungen schließen das wichtige Problem der Ableitungsmöglichkeit des Denkens ein, mit dem wir uns noch beschäftigen werden.
Damit haben wir alles in der Hand, um den Ausgangspunkt aller Wissenschaft und Philosophie formulieren zu können. Wir folgen wieder Rudolf Steiner:
„Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines solchen bewusst ist. Die Verrichtungen des gemeinen Menschenverstandes und die verwickeltsten wissenschaftlichen Forschungen ruhen auf diesen beiden Grundsäulen unseres Geistes. Die Philosophen sind von verschiedenen Urgegensätzen ausgegangen: Idee und Wirklichkeit, Subjekt und Objekt, Erscheinung und Ding an sich, Ich und Nicht-Ich, Idee und Wille, Begriff und Materie, Kraft und Stoff, Bewusstes und Unbewusstes. Es lässt sich aber zeigen, dass allen diesen Gegensätzen der von Beobachtung und Denken, als für den Menschen wichtigste, vorangehen muss.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 38)
Читать дальше