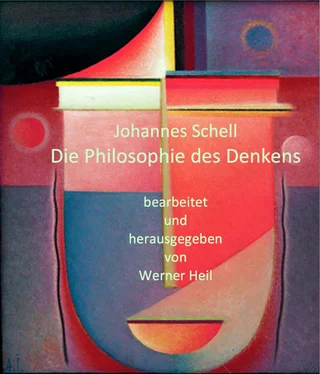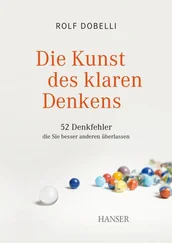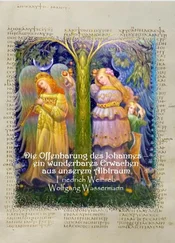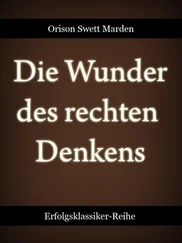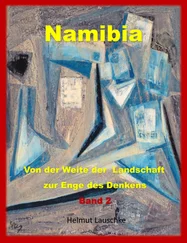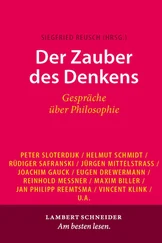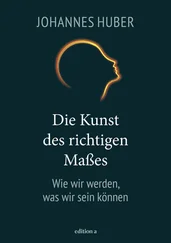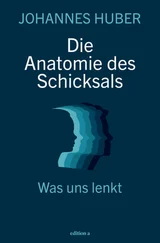1 ...6 7 8 10 11 12 ...28 „Es ist zweifellos: in dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, wo wir dabei sein müssen, wenn etwas zustande kommen soll.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 49).
Wenn wir uns Rechenschaft ablegen, wo wir innerhalb des Weltgeschehens unmittelbar „dabei“ sind, dann müssen wir den Offenbarungseid leisten: alle äußeren Naturprozesse verlaufen ohne unser Zutun, aber auch die inneren Vorgänge unseres Körpers (Blutkreislauf, Herzschlag, Verdauung, Gehirnprozesse usw.) vollziehen sich im Dunkel des Unbewussten, nach ihren eigenen Gesetzen, d.h. jederzeit fremdbestimmt und prinzipiell dem menschlichen Zugriff entzogen. Sie sind immer existent, ob wir wollen oder nicht. Nur einen einzigen Vorgang gibt es, bei dem wir ständig dabei sind, weil wir ihn selbst in Gang setzen müssen, wenn es ihn geben soll: das ist die Denktätigkeit des Menschen. Das ist auch dann richtig, wenn wir aus Gewohnheit schon automatisch denken. Nirgends in der Welt existieren Begriffe, es sei den, wir bringen sie hervor und stellen sie uns gegenüber. Das ist ja einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir das Denken so leicht unterschätzen und manchmal bereit sind, es als eine Fata Morgana zu betrachten und vollständig zu entobjektivieren. So geistert es durch manche Wissenschaften und Philosophien als ein bloß „Subjektives“ (was immer das sei) und als rein „Selbstproduziertes“, das durch eine solche Entstehungsweise notwendig suspekt ist. Es gibt sogar Positivisten, die bereit sind, die Existenz des Denkens zu leugnen und an seine Stelle die Sprache zu setzen, von deren objektiver Realität sich jeder Mensch überzeugen kann. Dagegen werden wir gute Gründe auffahren. Aber zunächst bleiben wir bei unseren simplen Beobachtungen. Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir auf Eigenschöpfungen stoßen, wenn wir Begriffe bilden, und es stimmt auch, dass uns Welt- und Naturprozesse ohne unser Zutun gegenübertreten. Aber wir haben hier noch kein Recht, schon theoretische Bestimmungen vorzunehmen und voreilig von „subjektiven“ und „objektiven“ Prozessen zu sprechen. Wir teilen mit, was wir vorfinden, und stellen fest, dass Begriffe in uns entstehen, die auf irgendeine Weise mit jener Sphäre verbunden sind, die wir nicht hervorgebracht haben. Es besteht noch kein Grund, über diese Beobachtung hinauszugehen. Sie kann nur in der Feststellung münden, die Rudolf Steiner einmal so ausgesprochen hat:
„Und in der Überbrückung dieses Gegensatzes besteht im letzten Grunde das ganze geistige Streben der Menschheit“... Erst „wenn wir den Weltinhalt zu unserem Gedankeninhalt gemacht haben, erst dann finden wir den Zusammenhang wieder, aus dem wir uns selbst gelöst haben.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 28)
Ich zitiere jetzt schon diese etwas weiterführende Stelle, um die Bedeutung unserer Beobachtung abzuschließen. Bringen wir die beiden genannten Pole ins Spiel miteinander, dann entsteht der von Rudolf Steiner angegebene Zusammenhang unmittelbar aus der Sache selbst, wenn man das menschliche Erkenntnisbedürfnis als beobachtbaren Tatbestand miteinbaut. Wenn wir den Begriffspol weiter im Auge behalten, stoßen wir auf ein viertes Phänomen, das uns deutlich gegenübertritt, ohne dass wir jetzt schon in der Lage wären, Genaueres darüber zu sagen. Mit der Herstellung begrifflicher Relationen tauchen wir in ein Element ein, in dem wir uns gleichsam zu Hause fühlen: es erzeugt tiefe, gemeinhin unreflektierte Befriedigung, die ihre Wurzeln in einem „Evidenzerlebnis“ hat, das außer einem Philosophen niemand bezweifeln kann, mit anderen Worten: wir beruhigen uns im Element der Wahrheit, wenn wir das Glück haben, dass sie plötzlich erscheint, selbst dann, wenn wir irren, ohne es zu wissen. Nur hier erfahren wir mit absoluter Unmittelbarkeit, was im genauen Sinne des Wortes die so oft berufene „Selbstverständlichkeit“ überhaupt ist. Wir erleben sie logisch und psychisch, als Klarheit und Sicherheit, als existentielle Heimat, mit der wir uns verwachsen fühlen. Und wer den Wahrheitsbegriff als eine chimärische Täuschung ablehnt, gibt sich alle Mühe, ihn mit Hilfe logischer Argumentationen als persönliche Überzeugung wieder in sein Bewusstsein hereinzuholen und die gewollte innere „Befriedigung“ wiederherzustellen. Und wer sogar die gewöhnliche Logik noch als Subjektivum denunziert, tut das Gleiche auf eine etwas kompliziertere Weise, falls er seine Sicherheit behalten will. Sie werden gemerkt haben, dass wir hier bereits auf das früher so genannte „Junktim“ stoßen, und zwar ganz empirisch, aber ohne die Absicht, es jetzt schon untersuchen zu wollen. In unserer vierten Beobachtung begegnen wir einem Fixpunkt des Denkens, der durch keine geistige Operation zu beseitigen ist.
All das besagt natürlich nicht, dass wir irgend etwas darüber ausmachen könnten, was „Wahrheit“ ist. Die berühmte Pilatusfrage bleibt unbeantwortet, und Sie dürfen sich keine Hoffnung machen, dass ich in der Lage wäre, eine Antwort zu geben, wie sie gewöhnlich gewünscht wird. Aber wir werden über die „Wahrheit“ einiges zu sagen haben, das über den Zweifel ein wenig hinausführt und das Vertrauen in das Denken wieder herstellen dürfte.
Zur Verdeutlichung dieses Problems wollen wir den bekannten Gegenpol zur Wahrheit noch einmal abtasten: ich meine unsere Erfahrungen mit den „Dingen“ der Innen- und Außenwelt des Menschen, die in völlig rätselhafter Gestalt an uns herantreten und so gar nichts Evidentielles an sich haben, wenn wir keine Begriffe produzieren, um sie, wie man sagt, zu begreifen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich dabei um seelische Vorgänge oder „bewusstseinstranszendente“ Phänomene der Außenwelt handelt. Wir können jetzt schon sagen, dass Brentano im Irrtum war, wenn er glaubte, dass Innenwahrnehmungen evident seien. Sie sind nicht einmal unmittelbar, sondern mit Begriffen durchsetzt, wenn sie uns überhaupt ins Bewusstsein treten sollen.
Demselben Fehler ist Schopenhauer erlegen, wenn er den „Willen“ als essentiellen Weltgrund hypostasiert, ohne die konstituierende Aufgabe der Begriffe zu berücksichtigen. Ich wiederhole noch einmal die beiden Elemente, die sich zunächst anbieten, wenn wir die ersten Beobachtungen machen: wir nehmen zwei voneinander unterscheidbare Sphären wahr: (1) das Reich der Begriffe, das dann, aber auch nur dann vorhanden ist, wenn wir es selbsttätig hervorbringen, und (2) die immer vorgegebenen „Dinge“ der Innen- und Außenwelt, an deren Zustandekommen wir nicht den geringsten Anteil haben. Und wir stellen fest, dass beide Sphären in dauernder Wechselwirkung stehen. In der ersten Wahrnehmungsweise vermittelt das eigene Tun das schon erwähnte Gefühl der geistigen „Befriedigung“, ein sog. „Wahrheitserlebnis“, dem wir unsere Sicherheit verdanken, in der zweiten Wahrnehmungsweise entsteht das Erlebnis eines absolut Anderen und damit die Rätselhaftigkeit des vorgegebenen Weltinhalts, das platonische „Staunen“, das erst in begrifflichen Relationen seine Aufhebung findet. Mehr lässt sich hier noch nicht sagen, oder man bemüht wieder die Relikte der überholten „Bewusstseinsphilosophie“, die mit voreilig produzierten Begriffen wie „Vorstellung“, „Evidenz“, „Bewusstsein überhaupt“ u.a. gearbeitet hatte. Wir stehen - und mehr gibt unsere Beobachtung noch nicht her - zwei Phänomenen gegenüber, die wir der Genauigkeit halber so bezeichnen wollen: Befriedigendes Selbstgetanes und Unbefriedigendes Nichtselbstgetanes. Erlauben Sie mir eine solche unschöne Formulierung. Sie hat die Aufgabe, einen Zusammenhang zu fixieren, der den Charakter einer notwendigen Korrelation haben könnte, die auf einen gemeinsamen Hintergrund hinweist. Rudolf Steiner hat zum ersten Mal in diese Richtung gedacht. Unser Problem ist nicht leicht zu erfassen. Es sei nur noch vermerkt, dass es völlig verfehlt wäre, bereits Begriffe wie „Subjekt“ oder „Objekt“ hier anwenden zu wollen.
Читать дальше