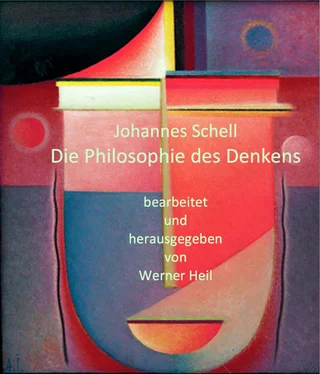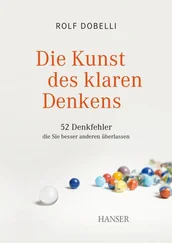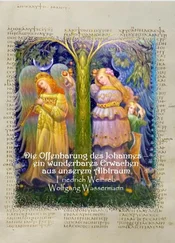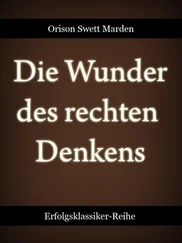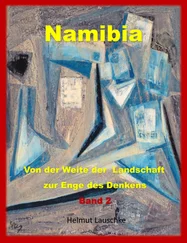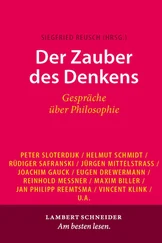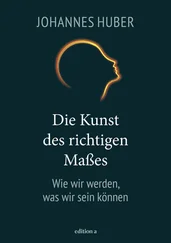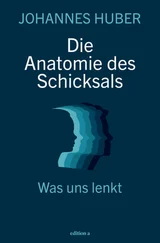Was geschieht nun rein aktologisch, wenn wir denken? Lassen Sie es mich einmal in der folgenden Weise sagen. Das bestimmungslose, in sich selbst neutrale Denken bringt Begriffe hervor, wenn ihm von „außen“ kommende Wahrnehmungen entgegentreten, mit denen es sich ideell auseinandersetzen muss. Diese neugeschaffenen Begriffe nehmen sofort die Gestalt von Gegenüberstellungen an und werden als „selbstproduzierte Wahrnehmungen“, als „Objekte“ unter Objekten behandelt, wie alle anderen, die wir begreifen wollen. Was tun wir nun? Wir unterbreiten die neuen Begriffs- und Sachzusammenhänge, d.h. unsere ideell geordneten Vorstellungen, wiederum dem bestimmungslosen Denken, um neue begriffliche Bestimmungen zu produzieren, mit denen dann in willkürlicher Folge immer dasselbe geschieht. Hier begegnen wir wieder der „intermittierenden Denkbeobachtung“, aber in deutlicheren Umrissen. Die unklar gebliebene „Denktätigkeit“, die unsere Begriffe hervorbringt, wenn das Ich den Anstoß gibt, erweist sich als die Arbeit des bestimmungslosen Denkens. Wenn wir den Pendelschlag vom Ich zur Gegenüberstellung in Gang bringen, aktivieren wir einen komplizierten Prozess auf der Seite des Ich-Pols, der die scheinbaren Gegensätze überbrückt. Wir arbeiten mit einem überlogischen Etwas, dem wir noch auf die Spur kommen wollen. Aber eine wichtige Schlussfolgerung können wir bereits ziehen, die weitreichende Folgen hat. Sie entsinnen sich des unlösbaren Problems der epistemologischen „Zirkularität“, von der wir einmal kurz gesprochen hatten: ich meine die Anwendung des Denkens auf das Denken, der Logik auf die Logik, desselben auf dasselbe - also jenen Kreislauf, den wir in logischer Hinsicht als widerlogisch ansehen müssen. Ich möchte es kurz machen: diese epistemologische Zirkularität existiert überhaupt nicht. Sie ist ein Scheinproblem, das dadurch zustande kommt, dass man von einem Denken ausgeht, das bereits in sich selbst logische Strukturen besitzt, denen zugemutet wird, sich auf sich selbst anzuwenden, sich also am eigenen Schopf aus dem Sumpfe zu ziehen. Strukturen, so sagten wir, können keine Strukturen erkennen. Was geschieht, ist etwas ganz anderes. Wenn ein Logiker sich Begriffsrelationen der reinen Logik zuwendet, um weitere logische Beziehungen aufzudecken und zu interpretieren, dann geht er von bereits fertigen Begriffen aus, von vorher produzierten Resultaten der Denktätigkeit, also von vorgefundenen Objekten, die eine begrifflich-logische Gestalt haben - und tut das Folgende: er unterbreitet sie dem bestimmungslosen Denken, um neue Begriffe oder Begriffskombinationen zu erhalten, die in der Lage sind, das logische Bezugssystem, mit dem er sich abquält, näher zu bestimmen. Diese Bestimmungen mögen verschiedene Grundlagen haben, sie mögen die logifizierte Form der realen Weltzusammenhänge sein, aber eines ist gewiss: sie sind in keinem Fall die Offenbarung von immanenten Strukturen des Denkens. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Erkenntnistheoretiker und Logiker haben das volle Recht, ihre epistemologischen und logischen Untersuchen anzustellen, sie geraten mit ihrem Denken nicht in Widerspruch, wenn sie nicht die Torheit begehen, ihre Begriffe und Begriffsbeziehungen für das Denken zu halten.
Mit diesen Überlegungen gerät auch die moderne Sprachphilosophie in ein neues Licht, das uns noch beschäftigen soll. Damit haben wir alles zusammengetragen, was wir brauchen, wenn wir das Denken untersuchen wollen. Wir werden aber einen neuen Ansatz machen, um unser Problem von einer anderen Seite angehen zu können. Vielleicht lässt sich alles, was uns bisher begegnet ist, noch besser begründen, wenn wir einen Stellungswechsel vornehmen.
D. DAS DENKEN ALS ABSOLUTUM
12. Ein Vorspiel aus dem Alltag
Es ist immer schwer, an das Denken heranzukommen, wenn man sich unvermittelt in die Höhenluft der Abstraktionen begibt. Wir werden gut daran tun, in anderem Zusammenhang noch einmal ganz von unten anzufangen, um eine erste Erfahrung zu machen, die jedem schon vielfach begegnet ist. Wie früher den Handwerker, der eine Maschine bauen will, so lassen Sie uns jetzt eine schlichte Hausfrau heranziehen, die gewiss unverdächtig sein wird, philosophischen Spekulationen nachzulaufen. Damit fallen auch alle theoretischen Vorbelastungen, die uns verwirren könnten, hinweg.
Stellen Sie sich eine ganz solide und normale Hausfrau vor, die gerade dabei ist, am Monatsende Bilanz zu machen, um ihre Ausgaben zu überprüfen. Sie wird alle Kosten gewissenhaft addieren und die errechnete Endsumme von der Erstsumme ihres Haushaltsgeldes abziehen, um herauszufinden, was übrigbleibt. Dabei, so wollen wir annehmen, stellt sie zu ihrem großen Erstaunen fest, dass sie ihr Konto überzogen hat. Sie steht jetzt im Minus und hat Schulden. In ihrer Aufregung ruft sie den Ehemann und bittet ihn, die vorliegende Rechenoperation noch einmal sorgfältig zu wiederholen. Aber auch seine Nachprüfung nützt nicht das geringste: die Zahlen stimmen, einen Ausweg gibt es nicht. Der negative Differenzbetrag bleibt trotz weiterer Überprüfungen unerbittlich derselbe. Unsere brave Hausfrau möge sich schon vor dieser alarmierenden Tätigkeit, so wollen wir wiederum annehmen, in reichlich komplizierten Gemütszuständen befunden haben: vielleicht hatte sie großen Ärger, körperliche Schmerzen oder gesundheitliche Sorgen, vielleicht auch Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten oder sogar einen Trauerfall in der Familie - wie dem auch sei, nichts von all diesem hatte auch nur den geringsten Einfluss auf das Endergebnis der Rechenoperation. Die Bilanz steht auf unabhängigen Boden, nicht mediatisiert und nur sich selbst verantwortlich. Und wenn sie - nehmen wir auch das einmal an - durch die Hände aller Menschen auf dieser Erde gegangen wäre, durch sämtliche Rassen und Völker, durch alle Mentalitäten und Entwicklungsstufen, unter allen geographischen, klimatischen und hygienischen Bedingungen, das Resultat der Bilanz wäre immer und überall dasselbe, natürlich die Fähigkeit zum Rechnenkönnen vorausgesetzt. Würden wir uns die Mühe machen, diesen Sachverhalt unserer Hausfrau ins Bewusstsein zu heben, dann wäre sie wohl erstaunt darüber, dass wir ihr so etwas „Selbstverständliches“ klarmachen wollen, aber es dürfte einige Zeit kosten, ihr die Bedeutung ihres natürlichen Wissens („das weiß man doch“) zu erklären: nämlich die überraschende Tatsache, dass sie in ihrem Inneren einem objektiven Element begegnet, das gar nicht so privat ist, wie sie angenommen hatte. Im Extremfall könnte ihr naives „Ich denke“- Erlebnis in eine „Es denkt“- Erfahrung umschlagen, mit der sie kaum etwas anzufangen wüsste. Wir alle besitzen dem Denken gegenüber ein schier unverwüstliches Eigentumsgefühl, das wir gar nicht gerne aufgeben. Es will uns nicht in den Kopf, auch nicht in die Köpfe vieler Philosophen, dass so etwas Privates wie unsere täglichen Denkoperationen mit einer objektiven Realität verbunden sind, die weit über das Subjekt hinausragt und sogar die Kraft hat, uns selbst zu bestimmen. Dieser wesentliche Gedanke führt zur sog. „philosophischen Besinnung“, wenn er richtig angewandt wird. Natürlich melden sich sofort die erprobten Einwände, vor allem der simpelste, der überall ins Feld geführt wird: alle diese Überlegungen mögen für rein logische Zahlenoperationen ihre partielle Gültigkeit besitzen, aber was geschieht, wenn man sich sprachliche Formulierungen, also „Sätze“, gegenüberstellt und nach objektiven Gedankeninhalten sucht? Wir landen in einem Meer von Missverständnissen und Unklarheiten, die genau das vermissen lassen, was unsere Bilanz ausgezeichnet hatte. Wir fühlen, wie wir in der eigenen Subjektivität versinken, und reißen das scheinbar so unabhängige Denken mit in den Strudel höchstpersönlicher Seelenprozesse. Denken Sie nur an die berühmten Verführungen durch die Sprache, die uns von einer Falle in die andere lockt und uns Probleme vorspiegelt, die keine sind. So wenigsten sagen die Grunderkenntnisse der zeitgemäßen Sprachanalyse und Linguistik. Auch unsere Hausfrau, die wir nun verlassen wollen, weiß das instinktiv und wendet sich ihren realistischen Sorgen zu, die ihr auf den Nägeln brennen.
Читать дальше