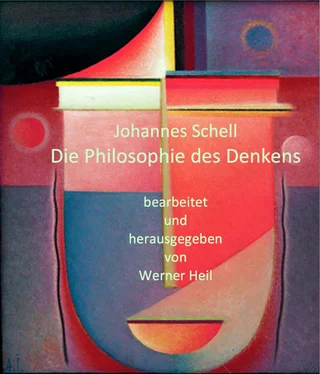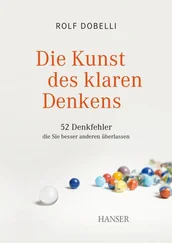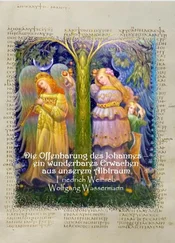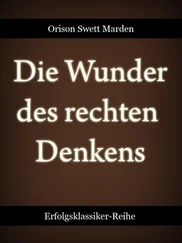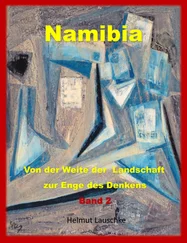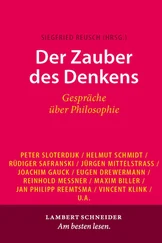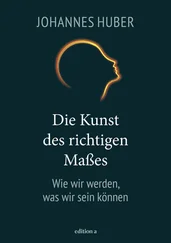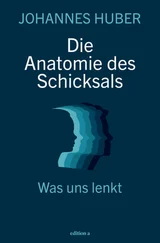Ich habe gerade von „Sätzen“ gesprochen, die wir denken, reden und schreiben können, und zwar mit der tatsächlichen Absicht, so etwas wie die „Wahrheit“ zu sagen, aber mit dem Ergebnis, dass sie die Wahrheit entweder verschleiern oder gar nicht enthalten. Hinzukommt, dass wir nicht einmal Kriterien besitzen, nach denen wir die Wahrheit bestimmen können. Gewiss, das Erlebnis der „Objektivität“ erfährt jeder, der sich mit dem Denken beschäftigt, aber sobald er den Inhalt seiner Gedanken kritisch behandelt, verliert er sehr schnell den Boden unter den Füßen. Wenn es möglich wäre, alle Wissenschaftsgebiete nach dem Vorbild der Naturwissenschaft mit exakten mathematischen Methoden zu bearbeiten, dann könnten wir Hoffnung schöpfen und uns im Weltzusammenhang weit sicherer bewegen als bisher. Aber leider sind alle Versuche dieser Art fehlgeschlagen oder nur zum Schein erfolgreich. Die geistreichen und sinnvollen Impulse eines Leibniz oder Carnap, so etwas wie eine universelle wissenschaftliche Kunstsprache zu schaffen, sind im Sande verlaufen, obwohl diese Forderung in der Luft liegt. Das hat schwerwiegende Gründe, die wir noch kennenlernen werden. Es wäre vom heutigen Standpunkt ein Segen gewesen, wenn wir uns ganz aus den Unklarheiten der Umgangssprache zu lösen vermocht hätten. Aber das alles ist Wunschdenken. Unser Weltverständnis wird niemals die brillante Simplizität der Bilanz unserer braven Hausfrau erreichen - und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dann die Evolution des Menschen methodologisch präjudiziert wäre, d.h. nach logischem Schema ablaufen müsste. Auf der andern Seite sind aber Ausdrücke wie „Erlebnis“, „Wahrheitsgefühl“ u.a. so verschwommen, dass sie jedem ernsten Wissenschaftler suspekt sein müssen, wenn er Wert auf unverzerrte Gedankenbildung legt, auf Präzision im intersubjektiven Austausch der Ideen. Damit scheinen wir uns selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Aber ich sage das nur, um Ihnen die Problemlage klarzumachen. Natürlich werden wir keine Gefühlsphilosophie entwickeln, auch nicht in der hohen Gefühlsgeistigkeit eines Jaspers, die bewundernswert ist, aber das Wissen verneint. Wir wollen das analytische Element nicht verleugnen und uns nicht mit rein „menschlichem Niveau“ begnügen, weil wir wissen, dass die Entwicklung zur „Humanitas“ mitten durch die Wissenschaft gehen muss. Unsere weiteren Beobachtungen werden diese Auffassung belegen.
13. Die Wahrheit und ihre Kogitate.
Die folgenden Ausführungen wenden sich bewusst gegen die weitverbreiteten und zweifellos bewundernswerten Formalisierungskünste unserer Tage, nicht aus Abneigung, sondern aus der Erkenntnis ihrer Unzulänglichkeit. So geistreich und neuartig zum Beispiel die Überlegungen eines Tarski sind; an dem, was wir Wahrheit nennen, gehen seine formalistischen Betrachtungen vorbei. Auch wir meinen das „true“ und nicht das „frue“ und sind der Meinung, dass es Wege gibt, die Wahrheit so aufzufassen, dass Tarskis Formalismen überhaupt erst in das rechte Licht gerückt werden können. Die logischen Seitenkanäle führen zu keinen brauchbaren Ergebnissen.
Wenn wir das Ganze des Denkens zu erfassen suchen, und damit den Begriff der Wahrheit, stehen wir vor beträchtlichen Schwierigkeiten. Auf diese Wendung vom Denkresultat zur Denktätigkeit kommt es Rudolf Steiner an. Er schreibt:
„Ich muss einen besonderen Wert darauf legen, dass hier an dieser Stelle beachtet werde, dass ich als meinen Ausgangspunkt das Denken bezeichnet habe, und nicht Begriffe und Ideen, die erst durch das Denken gewonnen werden. Diese setzen das Denken bereits voraus... (Ich bemerke das hier ausdrücklich, weil hier meine Differenz mit Hegel liegt. Dieser setzt den Begriff als Erstes und Ursprüngliches.)“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. Dornach 15. Auflage 1987, S. 57f.)
In einer anderen Schrift zitiert er Sätze eines zeitgenössischen Autors, um das Problem des Denkens in seiner zentralen Bedeutung und Schwierigkeit drastisch vor Augen zu führen; sie lauten:
„Zu welcher Philosophie man sich bekenne: ob zur dogmatischen oder skeptischen, empirischen oder transzendentalen, kritischen oder eklektischen, alle ohne Ausnahme gehen von einem unbewiesenen und unbeweisbaren Satz aus, nämlich von der Notwendigkeit des Denkens. Hinter diese Notwendigkeit kommt keine Untersuchung, so tief sie auch schürfen mag, jemals zurück. Sie muss unbedingt angenommen werden und lässt sich durch nichts begründen; jeder Versuch, ihre Richtigkeit beweisen zu wollen, setzt sie immer schon voraus. Unter ihr gähnt ein bodenloser Abgrund, eine schauerliche, von keinem Lichtstrahl erhellte Finsternis. Wir wissen also nicht, woher sie kommt, noch, wohin sie geht. Ob ein gnädiger Gott oder ein böser Dämon sie in die Vernunft gelegt, beides ist ungewiss.“ (Gideon Spicker: Philosophisches Bekenntnis eines ehemaligen Kapuziners. Zit. nach Rudolf Steiner: Freiheit, Unsterblichkeit und Soziales Wesen. Dornach 1990, S. 33)
Mit diesen dramatischen Hinweisen wird das Problem, das wir untersuchen wollen, in seiner immer wieder vergessenen Weltbedeutung erkannt - deshalb das Zitat -, aber wir stellen zugleich Formulierungen fest, die eine Menge Vorurteile enthalten, die unphilosophisch sind. Greifen wir zunächst auf unsere Erkenntnis zurück, die wir vorliegen haben. Erinnern Sie sich an das Phänomen des „bestimmungslosen Denkens“, das wir als besonderen Vorgang aus dem Gesamtprozess des Denken herausgelöst haben, ohne eine reale Trennung vorzunehmen. Erinnern Sie sich auch an die wichtige Feststellung, dass alle Produktionen des Denkens, also die sog. Kogitate, sich immer und ausnahmslos auf spezifische Gegenüberstellungen beziehen, also niemals ein allgemeines Absolutum aussprechen. Auch das, was ich soeben in Worte fasse, ist natürlich ein Kogitat, das sich auf das Denken bezieht, aber nur in Form der Abgrenzung und nicht als inhaltliche Bestimmung. Darüber werden wir noch zu reden haben. Allerdings ist der Begriff des Denkens am Denken gebildet, d.h. das Denken spricht sich selbst aus, wenn auch ohne Bestimmungen. Wir verbleiben, wie Rudolf Steiner einmal sagt, „in demselben Element.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. Dornach 15. Auflage 1987, S. 48.) Darin stecken natürlich eine Menge Probleme, die sich erst klären, wenn wir weitere Beobachtungen machen. Lassen Sie uns schrittweise vorgehen.
a. Da ist zunächst die „Erkenntnisbefriedigung“, von der wir bereits gesprochen hatten. Um welche Art von Befriedigung handelt es sich hier? Wenn wir einen Erkenntnisvorgang zu Ende gebracht haben, dann hören wir nicht willkürlich zu denken auf, wie es uns gerade beliebt: es ist vielmehr so, dass wir aufhören müssen, weil die ideelle Motivation wegfällt. Das Denken kommt vorübergehend in sich selbst zur Ruhe, nimmt das Ergebnis wahr und hat das Gefühl, dass der Kreis geschlossen ist. Alle Begriffe und Begriffsrelationen tragen sich gegenseitig, ein Endpunkt ist erreicht, der uns zwingt, aus unserer Arbeit zurückzutreten. Rudolf Steiner hat diesen ausgeglichenen Zustand der Denkresultate „Harmonie“ genannt, womit er natürlich keinen ästhetischen, sondern einen logischen Zustand bezeichnen will. Hören wir ihn in größerem Zusammenhang:
„Wie erscheint uns unser Denken für sich betrachtet? Es ist eine Vielheit von Gedanken, die in der mannigfachsten Weise miteinander verwoben und organisch verbunden sind. Diese Vielheit macht aber, wenn wir sie nach allen Seiten hinreichend durchdrungen haben, doch wieder nur eine Einheit, eine Harmonie aus. Alle Glieder haben Bezug aufeinander, sie sind füreinander da; das eine modifiziert das andere, schränkt es ein und so weiter. Sobald sich unser Geist zwei entsprechende Gedanken vorstellt, merkt er alsogleich, dass sie eigentlich in eins miteinander verfließen. Er findet überall Zusammengehöriges in seinem Gedankenbereiche; dieser Begriff schließt sich an jenen, ein dritter erläutert oder stützt einen vierten und so fort... Alle Einzelgedanken sind Teile eines großen Ganzen, das wir unsere Begriffswelt nennen... Tritt irgendein einzelner Gedanke im Bewusstsein auf, so ruhe ich nicht eher, bis er mit meinem übrigen Denken in Einklang gebracht ist. Ein solcher Sonderbegriff, abseits von meiner übrigen geistigen Welt, ist mir ganz und gar unerträglich. Ich bin mir eben dessen bewusst, dass eine innerlich begründete Harmonie aller Gedanken besteht, dass die Gedankenwelt eine einheitliche ist. Deshalb ist uns jede solche Absonderung eine Unnatürlichkeit, eine Unwahrheit... Haben wir uns bis dahin durchgerungen, dass unsere ganze Gedankenwelt den Charakter einer vollkommenen, inneren Übereinstimmung trägt, dann wird uns durch sie jene Befriedigung, nach der unser Geist verlangt. Dann fühlen wir uns im Besitz der Wahrheit.“ (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 56f.)
Читать дальше