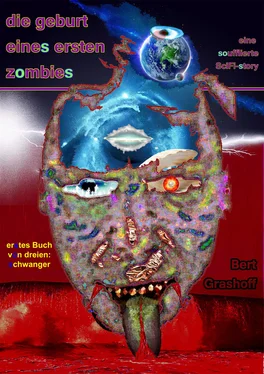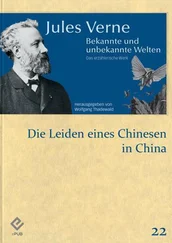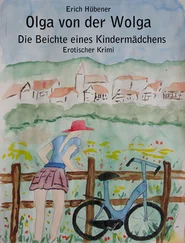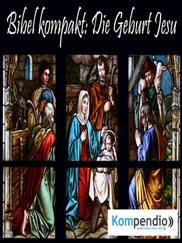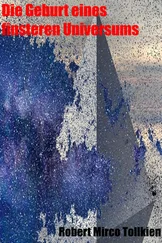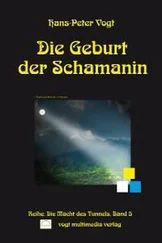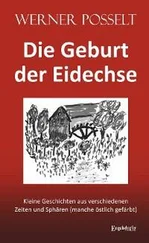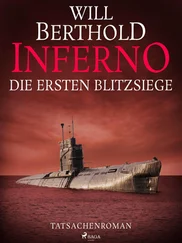Wieder ging ein Finger in der großen Schar der Studierenden hoch. Bell schwankte kurz, ob es wichtiger war, konsequent die Einhaltung akademischer Höflichkeitsregeln einzuüben, oder ob es wichtiger war, mit den neuen Studenten in ein Gespräch zu finden. Er entschied sich für Letzteres. „Gut. Ich lasse Ihren Redebeitrag entgegen meiner Ankündigung zu. Stehen Sie bitte auf.“
Eine junge Frau mit puterrotem Kopf, zitterndem Körper und zitternder Stimme stand auf. Sie war offensichtlich sehr nervös, vor so vielen Unbekannten zu sprechen. Das Vorlesungspad informierte Bell nach wenigen Silben von ihr darüber, dass es sich um eine 19-jährige Frau aus Norwegen handelte, Lisa Engstrøm, 173 im IQ-Test und immerhin 98,7 Prozent in den Aufnahme-Tests. „Verzeihen Sie, Professor Bell, verstehe ich das richtig: Haben Sie eben gesagt, dass unser Denken fähig ist, seine eigene Begrenztheit umso mehr zu begreifen, je weiter es sich ausdehnt? Ich verstehe das nicht so recht.“ Sie setzte sich schnell wieder hin.
Bell dachte bei sich, dass es kein Wunder war, dass sie es nicht verstand. Wie sollte man so etwas auch verstehen? Und doch ging es. „Vielen Dank für Ihre Frage, Mrs. Engstrøm. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ausspreche, dass man Ihnen Ihre Nervosität angemerkt hat. Es ist nicht einfach, vor vielen unbekannten Menschen frei zu sprechen. Umso schöner finde ich, dass Sie es dennoch taten. Es gehört Mut und ein Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten dazu. Vielen Dank, dass Sie beides aufgebracht haben. Ich hoffe, dass Sie alle sehr schnell an diesem Institut dazu finden werden, diesen Mut und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubringen. Nehmen Sie sich bitte ein Beispiel an Mrs. Engstrøm.
Nun, zu Ihrer Frage: Sie haben völlig recht. Genau das habe ich auszudrücken versucht. Je präziser Sie verstehen werden, was wir alles über das Universum zu wissen glauben, desto klarer wird Ihnen werden, wie ungewiss dieser Glaube ist. Die Physik hat sich lange dagegen gewehrt, als eine interpretierende Wissenschaft zu gelten. Die Physiker hatten lange Zeit ihr Selbstbewusstsein in dem Glauben, dass sie eine präzise Wissenschaft betreiben, die in der Formelsprache der Mathematik die Welt so zu begreifen fähig ist, wie sie ganz unabhängig von allem Begreifen nun einmal ist. Viele technologische Errungenschaften schienen ihr seit dem Aufstieg der Optik im ausgehenden Mittelalter diesen Glauben empirisch zu bestätigen. Dieser Glaube fing jedoch mit den Entdeckungen des frühen 20. Jahrhunderts, also mit Relativitätstheorie und Schrödinger-Gleichung, an, überaus brüchig zu werden. Seit fast 40 Jahren, also seit Cartos' Wissenschaftsrevolution können wir ernsthaften Physiker endgültig nicht mehr abstreiten, dass naturwissenschaftliche Exaktheit und spekulative Interpretation keine Gegensätze sind. Vielmehr sind es zwei Seiten einer Medaille. Falls Sie die Muße finden, sich mit der Geschichte der modernen Mathematik zu befassen, werden Sie feststellen können, dass die Mathematiker bereits im 19. Jahrhundert vereinzelt eine Ahnung von dieser doppelseitigen Medaille entwickelten. Und es bleibt überhaupt eines der faszinierendsten Phänomene unserer Geistesgeschichte, dass eine große Menge an mathematischen Konstrukten ohne jeden Bezug zur naturwissenschaftlichen Forschung entwickelt wurde, die sich erst Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte später als präzise Modell-Sprachen für die empirischen Phänomene der Experimentalphysik erwiesen.
Das Denken ist ganz offensichtlich fähig, über sich selbst hinaus in die fremdartige Natur hinein zu denken. Das ist wie gesagt ein Grund dafür gewesen, warum ich Ihnen als eine Art Hausaufgabe nahelegte, Ihre Vorstellungskraft auf alle möglichen und unmöglichen Dinge zu richten. Tatsächlich ist es vermutlich falsch, von einer fremdartigen Natur in diesem Zusammenhang zu sprechen. Unser Denken ist ein Teil der Natur und wohl nur deshalb überhaupt fähig, von der Natur auch etwas zu begreifen. Unser Denken ist ebenso fähig, seine systematische Schwäche gegenüber den Phänomenen der Natur zu begreifen. Wie gesagt: Je mehr Sie begreifen werden, desto klarer wird Ihnen werden, wie unbegreiflich das ist, was Sie da begreifen. Die philosophisch vielleicht interessanteste Frage ist dann die, ob die Unbegreiflichkeit selbst eine Eigenschaft der Natur ist, oder ob bloß die Natur unseres Denkens noch nicht reif dafür ist, die Gesamtheit der Natur zu begreifen. Als forschende Wissenschaftler haben wir grundsätzlich die Hoffnung, diese Frage dahingehend zu beantworten, dass sich früher oder später ein absolutes Begreifen einstellen wird. Wie ich Ihnen aber schon sagte, gibt es andererseits eine ganze Reihe von Beweisen auf der Basis unseres heutigen Denkens, die sagen, dass diese Hoffnung sich nicht wird erfüllen können.
Nun, Mrs. Engstrøm, Sie sagten, dass Sie das nicht so recht verstehen. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass Sie es in den nächsten Jahren Stück für Stück besser verstehen werden. Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass ich es sehr gut verstehe. Und dennoch kann ich Ihnen nur beipflichten: Ich verstehe es nicht so recht.“
Bell musste unwillkürlich grinsen bei dem letzten Satz. Das war der Auslöser für eine allgemeine Heiterkeit im Saal und viel Geraune und Getuschel. Bell wusste mit einem Blick auf die Uhr, dass er seinen Vortrag würde abkürzen müssen. Dennoch gab er der Unruhe unter den Studenten einen Moment Zeit und Raum.
„Lassen Sie mich bitte zu meinem Vortrag zurückkommen. Ich hatte gesagt, dass die Forschung im frühen 20. Jahrhundert zu dem Punkt gelangt war, an dem sich die Theoretisierung und Messung der Wirklichkeit selbst auf die zu messende und zu theoretisierende Wirklichkeit auswirkte. Dies wurde allerdings bis zu Cartos' revolutionärer Entdeckung von den meisten Physikern wiederum nur als ein Problem der Theorie interpretiert. Mit der sogenannten Dekohärenztheorie versuchte man, die irritierenden Ergebnisse der Quantenphysik von den Wissenschaften abzuschirmen, die sich mit größeren Gegenständen beschäftigten, also beispielsweise mit Molekülen oder noch größeren Körpern. Für die biologischen Disziplinen hatte die Quantenphysik de fakto überhaupt keine Bedeutung, was sich erst durch Cartos oder vielleicht ein bisschen früher ab Mitte der 20er Jahre grundlegend änderte.
Die Dekohärenztheorie basierte auf dem Nachweis, dass sich die Verschränkung von zwei oder mehr Teilchen schon nach etwa 10 -26Sekunden, also innerhalb unvorstellbar kleiner Zeitintervalle und auf sehr kurzen Distanzen innerhalb kleiner Moleküle auflöst. Eine geheimnisvolle Fernwirkung, die sich schneller als Licht bewegt, ja sogar instantan, also gleichzeitig das gesamte Universum durchdringt, wurde auf diese Weise genauso zurückgewiesen wie eine Fundierung der Naturwissenschaften in der nur statistisch zugänglichen Welt der Quanten. Man versuchte damit, den strengen Kausalitätsbegriff für die allermeisten Phänomene der Chemie, Biologie und Mechanik zu retten.
In einer ganz einfachen Weise kann man sich Verschränkung als ein Phänomen vorstellen, dass zwei Objekte so miteinander verbindet, dass eine Veränderung des einen Objekts eine gleichgerichtete Veränderung des anderen Objekts bedeutet. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie drehen ein altmodisches Buch auf Ihrem Schreibtisch einmal im Kreis. Alle einzelnen Seiten des Buchs sind in dem Sinne miteinander verschränkt, dass sie sich dabei auf gleiche Weise im Kreis drehen. Allerdings könnten Sie bei einem Quanten-Screening des Buches erkennen, dass die Seiten dabei keineswegs in dem quantenlogischen Sinne verschränkt sind wie wir den Begriff allgemein benutzen. Die Bindung des Buches wird niemals so stabil sein, dass es nicht zu Verschiebungen der Seiten gegeneinander kommt. Diese Verschiebungen kann man vielleicht nicht mit dem bloßen Auge sehen, im Quanten-Screening allerdings überaus deutlich in gigantomanischen Ausmaßen. Im strengen Sinne sind die Seiten des Buches also nicht verschränkt. Wobei man auch das eigentlich nicht sagen kann. Der theoretisch interessante Knackpunkt liegt viel eher darin, zu verstehen, inwiefern die Seiten sowohl verschränkt als auch nicht verschränkt miteinander sein können. Die Verschiebung der Buchseiten gegeneinander hebt nämlich keineswegs die Verschränktheiten auf der Quantenebene auf. Allerdings führen genau diese Verschränktheiten zu der Verschiebung der Seiten gegeneinander, so dass wir im Prinzip die Analogie so auszudrücken gezwungen sind: Auf der Makro-Ebene unserer Alltagswahrnehmung sind die Seiten miteinander verschränkt, sie bewegen sich gleichgerichtet im Kreis bei der Drehung des Buches. Auf der Mikro-Ebene der Quantenwelt sind die Buchseiten gar nicht solche festen Gebilde wie wir mit unserer Alltagswahrnehmung vermuten. Es sind vielmehr fließende Formationen, Wellenfunktionen mit gewaltigen Ausmaßen, weitaus größer als das gesamte Universum unserer astrophysikalisch gebildeten Alltagswahrnehmung erscheint. Diese Wellenfunktionen sind in der Tat miteinander verschränkt. Allerdings ist ihre Verschränkung von einer Art, die zwischen die Makro- und die Mikro-Ebene eine Diskrepanz einschiebt: Wir können mit technischen Hilfsmitteln erkennen, dass sich die Buchseiten durchaus gegeneinander verschieben, also gar nicht die Verschränktheit besitzen, die wir aus der Makro-Ebene unserer Alltagswahrnehmung behauptet haben.“
Читать дальше