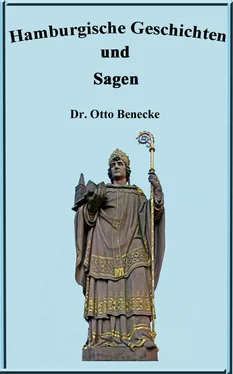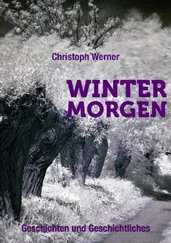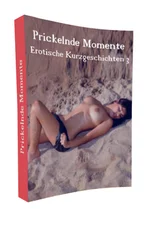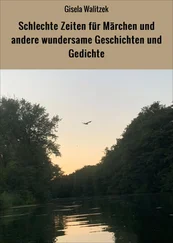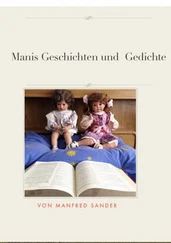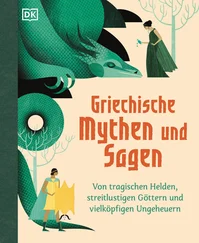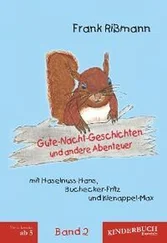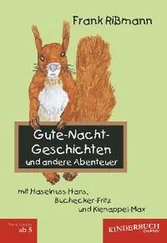11. Von Naturwundern, Wassernot, Leichenknäueln und Grabhügeln
(1020.)
Im Vorwinter des Jahres 1020 erschien zu öfteren Malen die Sonne mit einem lichten, breiten Kreise umgeben, in welchem viele Kreuze sichtbar waren. Und allnächtlich war der Schnee, der die Erde bedeckte, wie eine langsam wallende, rote Feuersglut anzusehen. Solche Abirrungen der Natur von ihren sonst so unwandelbaren Gesetzen konnten nichts Gutes bedeuten, und da obendrein die Winterkälte so entsetzlich hart war, dass viele arme Leute tot froren, so ermahnte der fromme Erzbischof Unwannus Geistliche wie Laien zu außerordentlichen Gebeten, zur Buße und Besserung, dieweil ein Gericht Gottes im Anzuge sei.
Bald danach schwollen nun auch Elbe und Weser furchtbar an, und ergossen ihre Fluten mit Sturm und Ungewitter über die Uferlande, dass die meisten Menschen auf der schnellen Flucht nur das nackte Leben retteten und unzählig viele jammervoll umkamen. Und während der drei Tage und drei Nächte, dass die Überschwemmung dauerte, haben die Fluten der Elbe und Weser zischend gebrodelt und gewallt, als wenn sie kochten und siedeten, und die Wellen haben wie Feuersflammen emporgeleckt, so dass Feuer und Wasser sonst einander so feindliche Elemente, Eins geworden waren.
Nachdem nun solche Empörung in der Natur sich gelegt und die Fluten allgemach sich verlaufen, hat man an vielen Stellen tote Menschen gefunden, die lagen in großen Haufen beisammen und waren durch tote Schlangen, welche sich um sie gewickelt, dergestalt mit den Gliedern verschlungen, dass man sie selbst mit Gewalt nicht voneinander trennen konnte. Also, da man sie einzeln nicht bestatten konnte, hat man da, wo sie lagen, Erde auf die Haufen geworfen und nach Art unserer ältesten Vorfahren mächtige Hügel darüber geformt, und riesige Steine darauf gewälzt.
Diese Hügel sind nach und nach eingesunken und niedriger geworden; und später, als sich immer mehr Menschen ansiedelten in den flachen, von Ihnen eingedeichten Marschen, da errichteten die ersten Anbauer ihre Wohnungen auf diesen Erhöhungen, deren Steine sie gut benutzen konnten. Daher finden wir mitten in den Elb- und Weser-Marschen manche Häuser auf kleinen Anhöhen, Worthen oder Wurten genannt, und die darin wohnen, wissen nicht, was unter ihren Füßen begraben liegt.
Gleich jenseits Grevenhof, dem Griesenwärder gegenüber, liegt eine Elbinsel, deren Hamburgischer Teil „Roß“, der Hannoversche aber „Neuhof“ heißt. Den Neuhof nannte man noch vor 125 Jahren den „Kirchhof“. Denselben meinte der fromme Mann Radecke to der Monnicke, als er Anno 1416 die Seemessengelder zu St. Jacobi um 10 Mark Jahresrenten vermehrte, um dafür unter anderem „das Gedächtnis der armen Seelen zu begehen, deren Leiber auf dem wüsten Kirchhof ruhen“. Es liegt nahe, einen der Begräbnisplätze von 1020 mit diesem „wüsten Kirchhof“ von 1416 in Verbindung zu bringen.
Ja, wenn man nur immer wüsste, was alles auf der Stelle passiert ist, wo man jetzt in behaglicher Länge und Breite sich streckt und dehnt, dann würde manch´ wunderbares Ding, was wir jetzt, obschon enträtselt, doch für eitel Täuschung der Sinne halten, ganz wohl denkbar sein.
Solch ein alter Leichenhügel kann nämlich einst auch dort gewesen sein, wo jetzt die Straße „der Holländische Brook“ sich befindet; bevor dieser Platz innerhalb der Stadt und Festungswerke zu liegen kam, war er ein Teil des Grasbrooks. Dann mag der Wall die Erde des Grabhügels, und das Fundament des ältesten der Häuser die Steine in sich aufgenommen haben. In diesem alten Hause aber ist von jeher viel Seltsames gehört und wohl auch gesehen, manch´ geisterhaft´ Wesen, im Vorüberwehen rauschend und wehend, bald stumm und still, bald seufzend und ätzend, - aus des Kellers Gründen durch alle Geschosse wandelnd bis zu des höchsten Bodens First, dann wieder verhallend in die Tiefe hinab schwebend. Der dies schreibt, der ist in diesem Hause geboren und groß geworden. Jetzt aber ist es längst abgebrochen, und der Platz mit einem modernen, mittelalterlichem Spuk unzugänglichen Hause bebaut.
12. Adalbert, Erzbischof von Hamburg
(1043-1072.)
Nachdem um Ostern 1043 zu Bücken im Hoya`schen Herr Alebrand, der viel geliebte Erzbischof von Hamburg und Bremen, „das irdische Pascha mit den himmlischen ungesäuerten Broten“ vertauscht hatte, wurde in demselben Jahre Herr Adalbert, geborener Graf von Wettin, zuvor Domprobst von Halberstadt, sein Nachfolger. Das erzbischöfliche Pallium empfing er durch Gesandte des Papstes Benedikt IX., worauf seine Ordination zu Aachen Statt hatte, im Beisein Kaiser Heinrich III. und vieler Reichsfürsten, mittels Einsegnung durch zwölf Bischöfe. Nachdem er sodann Bremen besucht hatte, wandte er sich und seine Tätigkeit der Hamburgischen Kirche zu.
Erzbischof Adalbert hegte für seine Hauptstadt Hamburg eine große Liebe, und allemal residierte er hier, so oft seine vielen Kirchen- und Staatsgeschäfte und seine dem Kaiser und Reiche gewidmeten Dienste, die ihn zu unaufhörlichen Reisen zwangen, dies gestatteten. Und da von der Hamburgischen Kirche aus seit deren Gründung das Christentum im ganzen Norden verbreitet worden war, ob zwar unter unsäglichen Kämpfen und dem Märtyrertum so vieler heiliger Sendboten, so nannte Adalbert Hamburg „die gesegnete Mutter aller Völker des Nordens“, welcher er um so freudiger Liebe und Ehrerbietung zolle, und um so eifriger hilfreiches Sorgen darbringe, je näher der Feind stehe, der ihre Herrschaft seit Jahrhunderten gleichsam wie ein Sieb durchlöchert habe. Und um deswillen baute er später das Kastell auf dem Süllenberge bei dem heutigen Blankenese.
So lange diesseits der Elbe Friede war, pflegte der Erzbischof alle Ostern- und Pfingst-, als auch Mutter-Gottes-Feste in Hamburg zu feiern, wo er in der Burg seiner Vorgänger, der Wiedenburg, Hof hielt und in der Domkirche das Hochamt selbst verwaltete. Zur Verherrlichung dieser hohen Feste zog er aus allen Stiftern seiner beiden Diözesen eine Menge von Geistlichen, zumal solche, die durch eine schöne Stimme in Predigt und Gesang die Gemeinde erwecklich zu erbauen verstanden. Und da er die Dienerschaft der Hamburgischen Kirche in großer Vollständigkeit erhielt, auch nichts sparte, um die gottesdienstlichen Handlungen sowohl mit innerer Würdigkeit als mit äußerem Glanze ausführen zu lassen., so mag wohl zu keiner Zeit der Kirchendienst in Hamburg in einer so herrlichen Weise versehen sein, als unter Adalbert. Und besonders viel hielt er auf den Chorgesang, den er in nie gekannter Weise einführte, und oft ließ er während dreier Messen, denen er beiwohnte, zwölf Litaneien absingen. Er mochte alles, in geistlichen wie in weltlichen Dingen, groß sehen, erhaben, bewundernswert. Darum erfreute sich sein Gemüt an dem wallenden Weihrauch der Spezereien, an der Pracht der heiligen Gefäße und Gewänder, an dem blitzenden Glanze der tausend Kerzen, an dem mächtigen Eindrucke des volltönenden Chorgesanges. Und diese äußerliche Pracht, deren heilsamen Einfluss auf die Gemeinde er wohl kannte, begründete er überdies durch die Herrlichkeit des Herren und seines Tempels, wie sie im Alten Testamente offenbart ist; wie es vieles, was den Leuten fremd erschien, nicht anders als in Übereinstimmung mit der heiligen Schrift getan hat.
Erzbischof Adalbert war ein Mann von ungewöhnlich großen Gaben und Gnaden. Bei einer vollkommenen Körper-Schönheit und Kraft vereinigte er in sich so viele Tugenden und Vorzüge des Geistes wie des Gemütes, dass es nur dem unglücklichen Gange der Weltbegebenheiten, wie einem einzigen Fehler seines Charakters, zuzuschreiben ist, wenn er sein hohes Ziel: - die Erhebung der Hamburgischen Kirche zum Patriarchat über Nord-Europa zum Gegengewicht des Papsttums in Rom, nicht erreicht hat, was für ganz Deutschland gewiss die wichtigsten, segensreichsten Folgen gehabt haben würde. Er war verständig, gelehrt, weise, besaß eine wunderbare Gedächtniskraft und hinreißende Beredsamkeit; er war mäßig und keusch, großmütig und freigebig, wie es einem Fürsten so wohl ansteht., über alle Maßen; ein Freund des Gebens, ein Feind des Empfangens, kraftvoll im Ausführen der hochstrebenden Entwürfe seines großartigen Geistes; demütig vor Gott, mildfreundlich gegen Arme und Pilger, denen er oftmals kniend abends die Füße wusch in demütiger Nachfolge unseres Heilandes; aber stolz und gebieterisch gegen die Großen und Mächtigen dieser Welt. Und mit dieser letzten Eigenschaft hängt auch der einzige Fehler zusammen, den er anfangs hatte, ein Fehler, aus dem später so viele andere zum Unheil seiner selbst entsprangen: die die ruhmsüchtige Eitelkeit, diese „vertraute Hausmagd der Großen und Reichen“, wie sein bremischer Dom-Scholaster, Magister Adam, sie nennt. Und dennoch opferte er Eitelkeit und Ruhmsucht seinem hohen Ziele willig auf, als er im Jahr 1046 zum Papste erwählt werden sollte; er lehnte nämlich diese höchste Würde ab und veranlasste es, dass Suidger (als Clemens II.) den Römischen Stuhl bestieg. Der hamburgische Erzbischof war aber damals so mächtig, dass er den Dänenkönig Svend Estridson, der seine nahe Blutsverwandte Gunhilde von Schweden geheiratet hatte, wirksam in den Bann tun konnte.
Читать дальше