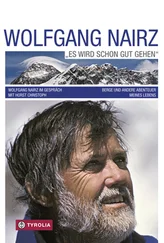Rainer, der sich keiner Schuld bewusst war, dem man aber Arroganz und Starallüren vorwarf, entschuldigte sich beim Vorstand und den Mitgliedern und schenkte dem Verein ein Konzert mit einer international renommmierten Koryphäe, die er persönlich kennt und die seinetwegen gern kam, sich nicht einmal die Flugkosten erstatten ließ und für wenig Geld spielte. Auch das legte ihm der Vorstand als »unerträgliche Renommiersucht« aus. Der Erste Vorsitzende, der bis eine Woche vor dem Konzerttermin weder einen Auftrittsort besorgt, noch die von Rainer selbst geschriebenen Pressemeldungen mitsamt teurem Fotomaterial verschickt, noch den Kartenvorverkauf arrangiert hatte, war bei der Bandzusammenstellung nicht berücksichtigt worden – ein Umstand, der Rainer nun, zu spät, angesichts der offensichtlichen Sabotage durch den Vereinsboss selbst, schmerzlich bewusst wurde.
Die 100 Plakate, die man angeblich vergessen hatte abzuholen, geschweige denn zu verteilen, warf man ihm einen Tag vor dem Konzert in den Hausflur. Er hängte sie noch in derselben Nacht eigenhändig auf, hatte inzwischen auch einen Club besorgt und den Vorverkauf geregelt, ganz nebenbei die Bandproben arrangiert und ohne die geringste Hilfe durch die Vereinsmitglieder einen Workshop mit dem Star organisiert und durchgeführt (die Zeitung schrieb: »als special offer des Jazzvereins«); schließlich beglich er auch die Kosten für die Plakate, für die die Druckerei keine Rechnung ausstellte, um dem Verein die Mehrwertsteuer zu ersparen, der sich daraufhin, da Rainer keine Rechnung vorlegen konnte, unter glaubhaftem Ausdruck tiefempfundenen Bedauerns für nicht zuständig erklärte.
Bis heute habe ihm die Jazzszene der Stadt nicht verziehen, dass er (obgleich stillschweigend und ohne die Sache an die große Glocke zu hängen) daraufhin einfach ausgetreten ist.
Er hatte sich wenig später, so schrieb Rainer weiter, bei der städtischen Musikschule beworben, wo man ihn aber abgelehnt habe, da er kein Diplom vorzuweisen hatte. Sein zusammen mit seiner Bewerbung eingesandtes »Modell eines Zweigs für Jazz und Popularmusik« übernahm die Schule allerdings. Zu den öffentlichen Sessions, die Teil seiner Alphabetisierungs-Vorschläge für die Szene waren und die nun ein ehrgeiziger Musikschullehrer in eigener Regie durchführte, wurde er nicht eingeladen.
Lucius’ Blick streift über die Fassaden, wandert vom Marktplatz über das alte Rathaus, die Marktkirche in Richtung des Hotel Brusttuch. In dieser Kirche könnte er damals gesungen haben, erster Sopran, vorne rechts, mit der Kantorei. Im Winter lugten die frostig geröteten Eisbeine aus den kurzen blauen Wollhosen. Der angststeife Nacken scheuerte sich am harten Kragen der engen gelblich verwaschenen Nyltesthemden wund, an denen sie beim Ausziehen elektrische Schläge bekamen; die unfreiwillig kurzen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Frisuren standen stramm. Die kleinen polierten Glühbirnen, die oben aus den zahngelben Hemdkragen lugten, waren rot angelaufen vor Scham über: Oh Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, während die Stones schon sangen: I can’t get noho ... Satisfaction.
Noch immer, wenn er, wie heute, Deoroller kauft, geht ihm Gloria In Exelsis Deo durch den Kopf. Und er muss daran denken, dass er vor gut zwanzig Jahren am Ausgang einer Coop-Filiale mit zwei nicht bezahlten Bak-Stiften erwischt worden war. Die Ermittlungsbehörden hatten ihm geschrieben: die Staatsanwaltschaft Hannover beschuldigt Sie, fremde bewegliche Sachen von geringem Wert einem anderen in der Absicht rechtswidriger Zueignung weggenommen zu haben, indem Sie Waren im Wert von 7,96 DM ohne Bezahlung mitnahmen. Beweismittel: Ihre Angaben, soweit Sie sich eingelassen haben; Zeugen. Wir halten Ihre Version, derzufolge Sie die Werbung »Mein Bak, dein Bak, unser Bak« bezüglich der Eindeutigkeit der Besitzlage für ebenso wenig glaubhaft, wie wir die Formulierung BAK-OUT als für sonderlich geistreich erachten – auch nicht Ihr Angebot, die Deoroller einem Waisenhaus zu schenken, sog. BAK-STIFTUNG. Also enweder er lasse es auf eine Verhandlung ankommen, wobei eine Gefängnisstrafe bis zu einer Woche drohe, mithin Aberkennung seines Doktortitels. Oder man einige sich auf einen Wert von sechs Tagessätzen. Das wären neunzig Mark. Er verzichtete auf die Pointe: Na dann nehme ich doch das Geld, und wir vergessen die Sache, um die Behörde nicht weiter zu erzürnen und stotterte den Betrag in monatlichen Sätzen zu zehn DM ab.
Dieses sandgraue Jungengymnasium könnte es gewesen sein. Alle Bullenklöster dieser Welt scheinen von ein und demselben Architektenkonsortium entworfen. Wie kriegt man es hin, dass trotz ausreichend vieler und genügend großer Fenster kein Licht reinkommt? Die Schildbürger hatten das Prinzip perfektioniert: Fenster ganz weglassen und nur so viel Licht, wie unbedingt nötig, mit Säcken reintragen. In der Aula des Gymnasiums, das Lucius besucht hatte, spielte auf der selben Bühne, auf der er sich in Bödekers postfaschistischen Blasorchester und Flötenchor mit »Und nun gang I an Peter's Brünnele« blamiert hatte (mit Klatschen auf Lederhosen und Schuhe zu Blödekers blödem hingeholperten Klavierzwischenspiel) blamiert hatte, später am Abend Arpad Bondy Vibraphon in einer Primanerjazzkapelle. Dabei übten sie mit der eigenen Band nachmittags schon einfachere Hendrix-Stücke. Seine Angebete, Gila, hatte peinlich berührt auf ihre Schuhe geschaut und war nach der Pause verschwunden. Und dreißig Jahre später trat dort Michel Petrucciani mit Steve Gadd auf. Lucius blickte sich während des Konzertes verstohlen um, ob er womöglich Zeugen dieses persönlichen musikhistorischen Debakels von damals ausmachen konnte. Erspähte aber außer dem ehemaligen Chorleiter, Donald Cramer, der (wie damals) noch immer milde abwesend lächelte, gottlob niemanden.
»Der Nagelkopf« , rechts: der mittelalterliche Marktplatz, den (für die damalige Zeit) wuchtige schieferverkleidete oder ihre Fachwerkbauweise offen (wie Kunstwerke) zur Schau stellende prunkvolle Häuser des wohlhabenden Handelsbürgertums und der Handwerker-Stände der ehemals reichen Hansestadt umsäumen. Links: das drohend düstere Massiv der Marktkirche. Dazwischen, vor der Seitfront des bald tausendjährigen Rathauses, an der eine wuchtige Steintreppe hinaufführt zur schweren Holztür vorm reich verzierten Sitzungssaal, steht ein einzigartiger kulturpolitischer Eulenspiegel-Streich des Magistrates der Stadt: ein großer, platter Eisenkopf ist von beiden Seiten mit riesigen Nägeln durchbohrt. Der Künstler hat dieses Monument der vernagelten Kunstborniertheit des kleinstädtischen Bürgertums den Ratsherren gewidmet, die ihn dafür reichlich entlohnten. Vielleicht sogar den Kaiserring überstreiften, eine Kunstauszeichnung, die auch Joseph Beuys bekommen hat. Womöglich für einen Klops Bunkerschmalz, den er in einen Glasschrei gestopft hat, wochenlang vor der Putzfrau verbarg, die den heute viel und gern zitierten Satz prägte: Is dat Kunst oder kann dat wech?! Und der Magistrat verwahrt ihn in den hieratisch gehüteten Gemächern des tumben Kulturfetischismus wie eine Heiligenmonstranz. Vor dem Stadttor hat er sich dann (wie weiland Eulenspiegel, der einem blöden Bürgermeister gerade ein nutzloses aber teures Zeugs aufgeschwatzt hatte) wohl in fettige Fäustchen gelacht. Bis der tiefere Sinn dieser einzigartigen Selbstentlarvung kulturpolitischen Kleingeistes diesem Monument entsteigt, wie einst die Athener Soldaten dem geschenkten Gaul in Troya, dem man nichts ins Maul aber in den Arsch hätte schauen sollen, und Passanten sich davor prustend auf dem Pflaster kullern, wird die graue kleinstädtische Mittelstandsmasse weiterhin kopfschüttelnd daran vorbeiflanieren: Für so'n Quatsch hamse Kohle!
*
Was das für ein Name sei, hatte der Beamte beim Ordnungsamt wissen wollen, wo Lucius Mitchell sein Pseudonym anmeldete. Und was das heiße!
Читать дальше