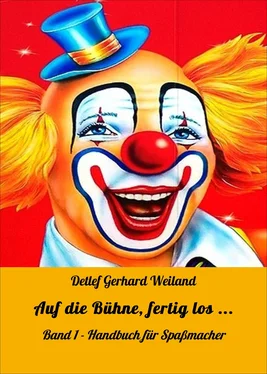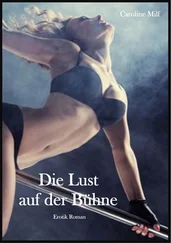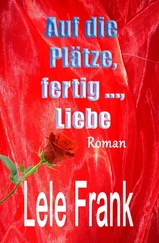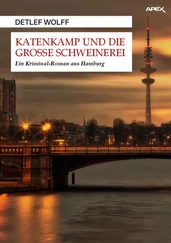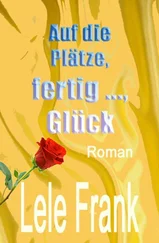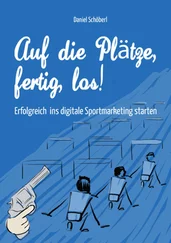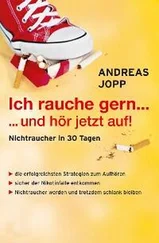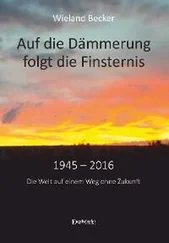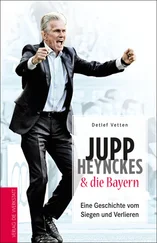Helmut Kohl hat jetzt 20 Kilogramm abgenommen. Das ist ungefähr das Gleiche, als würde ein Dreißig-Tonner eine Zierleiste verlieren.
Helmut Kohl wurde gefragt, ob er weiß, was ein Spastiker ist. »Natürlich weiß ich das«, sagte Kohl. »Das hat was mit Sex zu tun. Meine Hannelore fragt mich immer im Bett: ‘Na, macht’s Spaß Dicker?«
Angela Merkel ist jetzt auch in einen Spendenskandal verwickelt. Helmut Kohl hat ihr seinerzeit 50 Euro für den Friseur gegeben und keiner weiß, wo das Geld geblieben ist.
Goethe schrieb in den »Wahlverwandtschaften.«
»Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich finden.«
Schon Aristoteles behauptete, dass das Wesen des Witzes in einem Defekt bestehe. Hässliches sei darum komisch. Und Komödiendichter haben ja zu allen Zeiten Figuren auftreten lassen, die unter körperlichen Gebrechen zu leiden hatten. Gelacht wurde über Bucklige, Kleinwüchsige, Stotterer, »Tattergreise«, Betrunkene.
Nehmen wir zur Verdeutlichung zwei Gags über Kleinwüchsige (Liliputaner) und ein Beispiel über einen Stotterer. Achten Sie auf die Verdichtung und auf die prägnante Kürze der Witze. Die Pointe lässt nicht lange auf sich warten. Der Zuhörer braucht sich nicht endlos zu konzentrieren, bis er in den Genuss des Lachens kommt.
Kommt ein Liliputaner in die Kneipe und stellt sich neben einen Hünen. Er schaut ihn von oben bis unten an, stößt ihm in die Rippen und sagte: »Mensch Karl, kennst du mich denn nicht mehr? Wir sind doch zusammen groß geworden.«
Was sagt ein Liliputaner, wenn er nackt durch die Lüneburger Heide läuft? »Lass das Erika.«
Da fragt ein Stotterer einen Glatzkopf: »W-w-was ko-kostet b b bei dir ein Ha-Haarschnitt?«
Da antwortet der Glatzkopf: »16,50 €, genau so viel wie bei dir ein Ortsgespräch.«
Dieter Thoma meinte: »Was jemand witzig findet, hängt natürlich von jedem Einzelnen ab. Von seiner Veranlagung, seinem Geschmack. Der Lieblingswitz eines Menschen gibt auch psychologisch Auskunft über ihn.«
»Bei einem guten Witz ist mir egal, wen ich damit beleidige«, soll der US-amerikanische Komiker Mel Brooks gesagt haben.
»Sigmund Freud meinte, ein guter Witz sei imstande, Menschen selbst über körperliche Schmerzen hinwegzuhelfen. Und gerne erinnere ich mich an Fritz Muliar, den Wiener Schauspieler und grandiosen Witz-Interpreten. Er sagte: »Wenn das Tier einen tiefen Schmerz fühlt, dann schreit es. Der Mensch hat in so einem Fall noch einen Ausweg: Er kann lachen.«
Worauf es bei einem guten Witz ankommt?
Auf die Verdichtung, denn in der Kürze liegt die Würze. Erzählen Sie die Pointen bereinigt von jedem Ballast, das heißt: Füllwörter so wenig wie möglich verwenden. Vermeiden Sie Wiederholungen im fortlaufenden Text beziehungsweise beim Vorsprechen. Tätigkeitsworte sind besser als Substantive. Das lässt den Text lebendiger wirken. Komprimieren Sie den Gag auf ein Minimum. An einem Joke muss man schließlich auch arbeiten und rumfeilen, bis er flüssig passt, genauso wie an einem Werbeslogan.« Als kleines Beispiel die Schlegelsche Übersetzung:
»Weil Kürze dann des Witzes Seele ist,
Weitschweifigkeit der Leib und äußre Zierrat,
fass ich mich kurz.«
Schleiermacher wird zum Beispiel ein Witz zugeschrieben, der uns als fast reines Beispiel solcher technischen Mittel wichtig ist:
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
Wollen sich zwei wegen einer Frau duellieren. Der eine ist blind, der andere fast taub. Da fragt der Blinde seinen Sekundanten: »Hör mal, ist der Taube schon da?« Währenddessen fragt der Taube seinen Sekundanten: »Sag mal, hat der Blinde schon geschossen?«
Zum Tanztee spielt eine Zweimannkapelle. Der eine ist auch blind und der andere schwerhörig. Da fragt der Blinde: »Tanzen die Leute schon?« Verblüfft stellt der Schwerhörige eine Gegenfrage: »Wieso, spielen wir schon?«
Der Doppelsinn, die Zweideutigkeit
Zweideutige Witze sind vorwiegend sexistische Pointen, weil man gerne auf ein Thema zurückgreift, welches uns allen bekannt sein dürfte und für das wir uns alle gleichermaßen interessieren. Leider ist das Thema Sex ein zweischneidiges Schwert, eine Gratwanderung. Es gibt Veranstaltungen, bei denen Sie voll unter die Gürtellinie gehen können; und bei anderen Sitzungen wird man für das gleiche Erzählte mitten in der Rede abgebrochen. Darauf gehe ich später in einem anderen Kapitel näher ein. Das folgende Beispiel ist harmlos, weil nichts Genaues ausgesprochen wird. Der Zuhörer kann selbst entscheiden.
Er wirft ihr vor: »Es gibt Frauen, die können anziehen was sie wollen, ihnen steht einfach nichts.« Worauf seine Angetraute antwortet: »Es gibt Männer, die können ausziehen was sie wollen, da ist es genau das Gleiche.«
Lieber einen stehen haben und nicht mehr sitzen können, als einen sitzen haben und nicht mehr stehen können.
Er fragt seine Frau: »Hast du Lust zu bumsen?«
Worauf sie antwortet: »Nee, auf gar keinen Fall.«
»Ich auch nicht. Komm lass uns schnell anfangen, dann haben wir es hinter uns.«
Liebeserklärung:
In meinem Zimmer rußt der Ofen immerzu,
in meinem Herzen ruhst nur du.
»Eine Ziege stand einsam auf dem Feld,
und blickte traurig in die Welt,
sie rief ‘ne zweite Ziege dann herbei,
und gründete ‘ne Ziegelei.«
(Rolf Herricht & Hans Joachim Preil)
Das Wortspiel
Das folgende Wortspiel ist als rein solches zu betrachten, denn Doppelsinn und Zweideutigkeit sind nicht erkennbar. Diese Wortverdreherei ist etwas für Sprachgenies. Allerdings, aus eigener Erfahrung, nicht für jede Veranstaltung geeignet, weil der Zuhörer in seltenen Fällen nicht direkt mitkommt. Spricht man jedoch zu langsam, denkt der Zuschauer, man könne seinen Text nicht. Dieses Wortspiel habe ich mal 1995 auf einer Damensitzung gebracht und wurde ausgepfiffen. Eine Woche später bekam ich dafür einen riesigen Applaus.
Ich kannte mal ne Barbara, die aß immer so gern Rhabarber, da haben wir sie Rhabarber-Barbara genannt. Und die hatte einen reichen Onkel, der hat ihr eine Bar eingerichtet, die Rhabarber-Barbara-Bar. Und in dieser Bar hatte die sich Musiker verpflichtet aus Ungarn, die nannten sich Barbaren, das waren dann die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren. Diese Barbaren trugen alle einen Bart, den Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart. Den wollten sie sich abrasieren lassen, beim Barbier, beim Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier. Dieser Barbier war aber mal früher ein Baron, das war der Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier-Baron. Dieser Baron der hieß Baranie, also war das der Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier-Baron-Baranie. Dieser Baron Baranie hatte einen Bruder in Brasilien, der ihm immer Briefe brachte, also war das kein anderer als der: Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier-Baron-Baranies-briefebringender-Bruder aus Brasilien.
(Quelle unbekannt)
Eigentlicher Doppelsinn
Hierbei werden die Worte so verdreht, dass sie einen ganz anderen Sinn ergeben.
Nehmen wir als Beispiel einen DDR-Witz über den Schulunterricht:
Der Sohn kommt heulend von der Schule. Der Vater fragt ihn, was er denn für ein Problem habe. Ich habe in Deutsch eine fünf bekommen, weil ich ein Wort falsch geschrieben habe. Wir sollten schreiben, die DDR ist ein rechtmäßiger Staat.«
»Und, was hast du falsch gemacht?«
»Ich habe recht mäßig auseinander geschrieben!«
Читать дальше