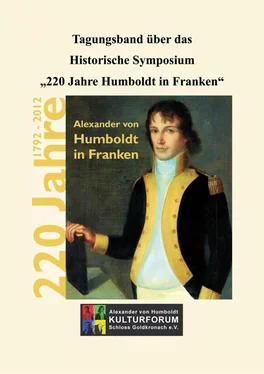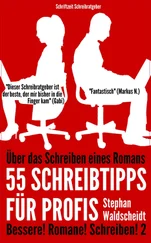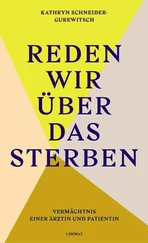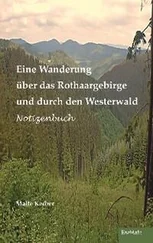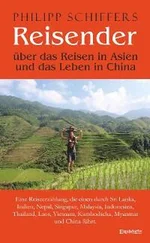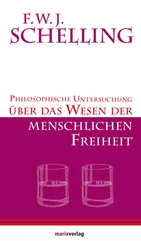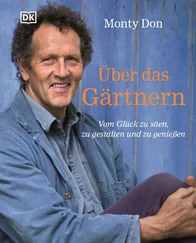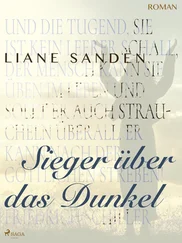Nach Erthals Tod am 14. Februar 1795 wählte das Würzburger Kapitel Georg Karl von Fechenbach (reg. 1795-1808) zum Fürstbischof. Trotz Unterstützung des Kaiserhofes konnte er sich in Bamberg nicht durchsetzen, weil er im dortigen Domkapitel nicht aufgeschworen war. Die Bamberger Kapitulare einigten sich nach langen Verhandlungen und verschiedenen politischen Pressionen auf einen schwachen Kompromißkandidaten, den greisen Regierungspräsidenten Christoph Franz von Buseck (reg. 1795-1802/1805). Auf Grund der politischen Umstände konnte er keine bedeutenden innenpolitischen Aktivitäten entfalten. Aus Treue zur Reichsverfassung lehnte er 1795 das Angebot Hardenbergs ab, Bamberg in die preußische Neutralitätszone einzubeziehen. 1796 mußten die fränkischen Bischöfe vor den heranrückenden Franzosen nach Böhmen fliehen, die Würzburg besetzten.
Das Hochstift Eichstätt umfaßte zu Ende des 18. Jahrhunderts noch 20 Quadratmeilen und 62000 Einwohner. Es bestand im wesentlichen aus zwei Teilen, einem größeren Komplex um Eichstätt an der Altmühl bis Berching im Norden und das Oberstift aus mehreren kleineren Gebieten um Herrieden, Ornbau, Abenberg und Spalt. Es verschloß sich anders als die mainfränkischen Diözesen weitgehend den Forderungen der Aufklärung. Als letzter Eichstätter Fürstbischof wurde Joseph von Stubenberg41 (reg. 1791-1821, †1824) 1791 gewählt. Die von Hardenberg mit harter Rücksichtslosigkeit durchgeführte Revindikationspolitik drohte auch die geistliche Jurisdiktion des Bischofs einzuschränken. Hardenberg entwickelte den Plan der Errichtung eines Generalvikariates für die Katholiken in den preußischen Territorien in Franken.42 1794/95 visitierte Stubenberg die Pfarreien und Klöster im Hochstift persönlich. Er unterstützte ein vom Bischof von Freising und Regensburg angeregtes Projekt einer Verbindung der geistlichen Reichsstände zur Erhaltung der Wahlstaaten,43 dem aber Würzburg und Bamberg fernblieben.
Das reichsunmittelbare Territorium des Hoch- und Deutschmeisters umfaßte zu Ende des 18. Jahrhunderts nur noch das Meistertum Mergentheim mit 10 Quadratmeilen und 32000 Einwohnern, das Amt Ellingen als Sitz der Ballei Franken war 1796 von Preußen okkupiert worden.44 Der Deutsche Orden, dessen Vertreter der Reichsdeputation angehört hatte, überstand zunächst den Reichsdeputationshauptschluß. Er wurde erst 1809 in den Rheinbundstaaten aufgehoben und säkularisiert, im Kaiserreich Österreich bestand er fort.
Auf der weltlichen Fürstenbank des Reichskreises saßen neben den beiden Markgraftümern, deren Stimmen nun von Brandenburg-Preußen geführt wurden, drei Linien der gefürsteten Grafen von Henneberg resp. deren Nachfolger und seit 1674 Schwarzenberg, seit 1712 Löwenstein-Wertheim und seit 1746 Hohenlohe-Waldenburg. Schon wegen der Beschränktheit ihrer Machtbasis waren auf Grund kleiner und vielfach zersplitterter Territorien die fränkischen Fürsten und Grafen darauf angewiesen, die Nähe und Unterstützung des Kaisers zu suchen.
An den Grenzen des fränkischen Reichskreises lagen die gefürstete Grafschaft Henneberg, deren Nachfolgeterritorien - neben Sachsen-Meiningen verfügten über Teile des Henneberger Erbes Kursachsen, Sachsen-Weimar, Sachsen-Coburg-Saalfeld, Sachsen-Gotha und Sachsen-Hildburghausen, Hessen-Kassel - und die gefürstete Grafschaft Hohenlohe. Sechs Linien der Fürsten von Hohenlohe gehörten dem Fränkischen Grafenkollegium an: Öhringen, Langenburg, Ingelfingen, Kirchberg, Bartenstein und Schillingsfürst. Die Grafschaft bildete insgesamt einen Fideikommißbesitz des Hauses, doch waren innerhalb der Grafenfamilie Teilungen die Regel. Sie umfaßte etwa 100000 Einwohner, die in 17 Städten - am bedeutendsten war Öhringen - , sieben Marktflecken und circa 250 Dörfern und Weilern lebten. Auch an diesen Territorien war die Aufklärung nicht spurlos vorübergegangen, doch blieben die Herrschaftsverhältnisse patriarchalisch geprägt.
Die übrigen Grafschaften beruhten auf Rodungsherrschaften. An den Rändern des Steigerwaldes lagen Castell, Limpurg, Schwarzenberg und Wiesentheid. Im Odenwald und Spessart befanden sich die Grafschaften Erbach, Löwenstein-Wertheim und Rieneck. Diese Territorien wurden nach der Gründung des Rheinbunds mediatisiert und unter den Rheinbundstaaten aufgeteilt.
Fünf Reichsstädte gehörten dem fränkischen Reichskreis an, welche die Städtebank bildeten. Nürnberg, eine der größten Reichsstädte des Alten Reiches, besaß das umfangreichste Territorium einer Reichsstadt.45 Dazu gehörten die sechs Städte Lauf, Hersbruck, Velden, Altdorf, Gräfenberg und Betzenstein. Über weite Teile des Nürnberger Territoriums bis vor die Stadtmauern beanspruchten allerdings die Markgrafen die Fraisch. 1796 wurden dies von Preußen unter Hardenberg mit militärischer Gewalt durchgesetzt. Kurbayern hatte bereits 1790 bis 1792 Okkupationen vorgenommen, um die Gebietsabtretungen des Landshuter Erbfolgekrieges, besonders des Pflegamts Velden, rückgängig zu machen. Das Territorium umfaßte so nur noch 30 Quadratmeilen und 30000 Einwohner.
Der Nürnberger Rat wurde ausschließlich vom Patriziat besetzt.46 Legislative, Exekutive und Jurisdiktion übte der Innere Rat aus. Die aristokratische Oligarchie hatte während des 18. Jahrhunderts zu einer gewissen Erstarrung der Politik geführt, die von einem wirtschaftlichen Niedergang infolge der merkantilistischen Politik der benachbarten Fürsten und einem Anwachsen der städtischen Schulden durch überhöhte Reichsabgaben begleitet war.47 So mußte Nürnberg in Friedenszeiten 20% und in Kriegszeiten über 50% seines Haushaltes für Kaiser und Reich zur Verfügung stellen. Moderne Manufakturen wurden in Nürnberg nicht gegründet, die Stadt verschloß sich weitgehend der gewerblichen Innovation. Der Größere Rat, in dem das Bürgertum und die Handwerker vertreten waren, erzwang mit dem Grundvertrag von 1794 die Teilhabe an der Stadtregierung, insbesondere das Mitspracherecht bei finanziellen Angelegenheiten.48 Allein 1796 erwuchs der Reichsstadt durch französische Einquartierungen ein Schaden von über drei Millionen Gulden. 1796 hatte der Rat die Reichskleinodien zum Schutz vor den Franzosen über Regensburg an den Kaiserhof bringen lassen. Wegen der desolaten Finanzlage wurde die Reichsstadt seit 1797 von einer kaiserlichen Subdelegationskommission regiert. Die kirchliche Aufklärung erfaßte um die Jahrhundertwende die Liturgie, die Apostel- und Marienfeiertage wurden 1805 abgeschafft.49
Neben Nürnberg saßen Rothenburg,50 Schweinfurt, Weißenburg und Windsheim auf der Städtebank des Fränkischen Kreises. Während Rothenburg mit seinem umfangreichen Territorium den Rang einer Mittelstadt beanspruchen konnte, waren die übrigen drei nur Kleinstädte mit Mittelpunktsfunktionen in reichen Agrargebieten. Auch ihre Geschicke wurden von patrizischen Oligarchien bestimmt, sie lehnten sich eng an Nürnberg an.
Nun ist noch die Reichsritterschaft vorzustellen, die sich endgültig Mitte des 16. Jahrhunderts aus den landesfürstlichen Territorien gelöst und als eigenständige Korporation organisiert hatte.51 Allerdings konnte sie keine Kreisstandschaft erwerben. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 hatte sie die Religionshoheit errungen. Die territoriale Ausdehnung des fränkischen Ritterkreises übertraf noch die des Reichskreises. Die „reichsfrey ohnmittelbare Ritterschaft Landes zu Francken“ war in sechs Kantone oder Ritterorte organisiert: Odenwald, Gebürg, Rhön-Werra, Steigerwald, Altmühl und Baunach. Die Reichsritterschaft stand unter dem besonderen Schutz des Kaisers, dem sie ihrerseits Einflußsphären am Rande und innerhalb der sich verfestigenden Territorialfürstentümer offenhielt. Sehr selbstbewußt bezeichnete sich ein Angehöriger der Ritterschaft und zugleich brandenburg-ansbachischer Minister, Christoph Ludwig von Seckendorff-Aberdar, 1754 anläßlich einer Geburtstagsfeier für Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach als freier Franke: „Ein freyer Frank feiert seines Fürsten Fest mit andern freyen Franken in einer freyen Stadt.“52 Der leider viel zu früh verstorbene bedeutende Kenner des fränkischen Adels, Gerhard Rechter, hat gezeigt, daß Franke hier aber im Verständnis des Reichsritter nicht in erster Linie die landschaftliche Zugehörigkeit charakterisieren sollte, sondern in der Verbindung mit frei als ständisches Merkmal zu werten ist.53
Читать дальше