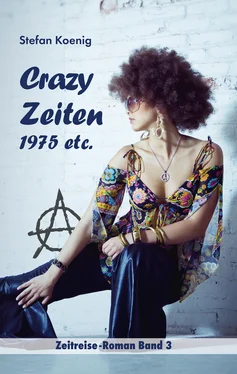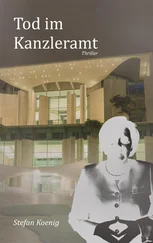Ich kannte das historische Tanger aus der Literatur. Hier hatte Marokkos berühmtester Schriftsteller, Mohamed Choukri, gelebt und seine Erfahrungen als armer Heranwachsender im Tanger der 1950er Jahre in seinem Roman „Das nackte Brot“ verarbeitet. In den 1960er Jahren und jetzt, Mitte der Siebziger, erlebte die Stadt eine zweite literarische Blüte als „Mekka“ von europäischen und US-amerikanischen Schriftstellern der neu entstandenen Popliteratur. Paul Bowles, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Truman Capote und William S. Burroughs waren nur einige von ihnen.
Nun also gehörte Tanger zu Marokko. Hassans Aufgaben wurden damit zwar leichter, aber nicht um vieles leichter. „Damals“, so sagte er uns in seinem Büro, „wäre Svea wahrscheinlich in eines der besser geführten Bordelle jenseits der Stadtgrenze geschmuggelt worden. Heute gibt es Edelbordelle auch innerhalb der Stadtgrenzen.“
„Konnten Sie schon Ihren Aufenthalt ermitteln?“, fragte ich.
„Jedenfalls hat sie Tanger weder mit dem Flugzeug noch per Fähre verlassen. Ich habe alle jeweiligen Außenposten informiert und wenn sie eines dieser Verkehrsmittel nehmen würde, hätten wir sie. Sie muss irgendwo hier sein. Wir werden sie finden, glauben Sie mir.“
Er machte uns keineswegs falsche Hoffnungen, aber er konnte uns überzeugen, dass er und sein Team sie finden würden, wenn sie überhaupt gefunden werden konnte.
Am nächsten Tag trafen Stella, ihre beiden Liebhaber und Wolle im Hotel ein; den Bulli parkten sie im bewachten Hof, was kostenfrei war. Wir gingen zum Polizeirevier und Stella überreichte dem Kommissar die Kopie eines Passfotos, was sie noch gefunden hatte. Svea hatte es ihr damals am ersten Tag ihrer Bekanntschaft aus Sicherheitsgründen gegeben. „Falls du mich mal suchen musst“, hatte sie damals zu Stella gesagt und dabei gelacht.
„Dich suchen?“, hatte Stella zurück gefragt.
Und Svea hatte geantwortet: „Falls ich mal so zugekifft bin, dass ich nicht mehr nachhause finde und zwei oder mehr Tage verschollen bin.“
Hassan kam mit seinen Ermittlungen am ersten Tag nicht voran. Mit einer weiteren Kopie von Sveas Passfoto unternahmen wir nun zu viert eine Suchaktion. Sören, John, Stella und ich klapperten Bar für Bar ab, in der sich Araber und Touristen aus aller Herren Länder befanden. Sören kannte sich hier erstaunlich gut aus. Endlich räumte er ein, dass er bereits vor zwei Jahren in Tanger in Sachen Rauschgift unterwegs gewesen war. Daher kannte er den einen oder anderen Barbesitzer. Das war uns jetzt eine große Hilfe. Wieder hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass er etwas gutmachen wollte – für Svea.
John fragte mich zwischendurch immer wieder, ob ich an ein glückliches Ende glaubte. Regelmäßig antwortete ich mit dem Allerwelt-Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Das war zwar nicht besonders klug, aber auch nicht besonders dumm, jedenfalls diplomatischer als ein bloßes Achselzucken.
Wir zeigten sämtlichen Barbesucher das Passfoto und fragten, ob sie die Dänin gesehen hätten. Wir stellten fest, dass sie die erste Nacht wohl mit einem Araber die Bars abgegrast hatte. Anscheinend hatte sie ihn erst hier kennen gelernt. Aber niemand konnte etwas zu ihm sagen.
Was für Marrakesch der Djemaa el Fna, war für Tanger der Zoco Grande, den wir nun nach Svea absuchten. Wir fanden keine Spur von ihr. Auf dem Platz saßen viele Weltenbummler und sogenannte Spätgammler, viele Alt-Hippies neben ein paar Junghippies. Sie hatten es sich auf dem Boden bequem gemacht. Dazu reichten ein paar Zeitungen als Sitzunterlage. Superkomfortabel hatten es jene, die ihren Schlafsack als Unterlage nutzten. Vor sich hatten sie Tücher ausgebreitet, auf denen sie handgefertigten Schmuck und selbstgeschriebene Reisebeschreibungen mit Adressen-Hinweisen für günstige Übernachtungen und allerlei Krimskrams verkauften.
Man spielte auf der Klampfe oder trommelte auf Bongos, sang lyrische Songs oder Protestsongs der längst vergangenen Sechziger. Wir fragten die jungen Leute, ob jemand Svea gesehen habe. Drei Holländerinnen, die gewiss seit einigen Wochen keine Dusche genossen hatten, versicherten uns, sie hätten sie in einer Art Jugendherberge namens »Jardins des Tanger« getroffen und auch ein paar belanglose Worte mit ihr gewechselt. Das gab uns Hoffnung.
Für einen Dollar machten sie sich in der Mittagssonne mit uns auf und führten uns durch vor Schmutz starrende Gassen zu einem ziemlich maroden Gebäude. Es gab keinen Portier und eine unbesetzte Rezeption. So gingen wir erfolglos von Zimmer zu Zimmer. Oben angekommen, hatten wir einen wunderbaren Überblick über die Stadt. Während wir unsere nächste Suchaktion besprachen, kam ein arabischer Mitdreißiger die Treppe heraufgeschnaubt. Stella zeigte ihm das Foto. „Ja, hier war eine Frau mit diesem Aussehen“, räumte er ein. „Nur eine Nacht. Ja, sie war in Begleitung mehrerer junger Marokkaner. Nach dem Morgenmokka gingen sie wieder.“
Mehr konnte er nicht sagen. Unsere Hoffnung schwand dahin. So gingen wir zurück zur Polizeistation. Wir wollten mit Hassan und unseren Freunden Wolle, Gerd, Leif und Jan-Stellan, die ihrerseits auch nach Svea gesucht hatten, besprechen, was nun zu tun sei.
Unser Herz schlug höher, als Hassan auf uns zukam und sagte: „Wir haben sie gefunden. Doch sie ist nicht in bester Verfassung.“
„Was ist mit ihr?“, fragte John erregt.
„Sie ist unterernährt, dazu das Rauschgift, Drogen, Heroin, was immer. Nichts Ungewöhnliches. Sie ist im Krankenhaus.“
Wir fuhren allesamt mit seinem Polizeiwagen und mit Wolles Bulli zum Stadtrand in die Klinik. Sie wurde von katholischen Schwestern geführt. Eine der liebenswürdigen Nonnen stellte sich als Oberschwester vor, warnte uns jedoch sogleich vor zu großem Optimismus. In diesem Moment musste ich daran denken, wie schwer es dieses muslimische Land den christlich motivierten Ordensschwestern einst gemacht hatte.
Aber eine Münze hat immer zwei Seiten. Aus Sicht der Moslems war die Aktivität der christlichen Gemeinschaft in ihrem Land eine Art ideologischen Untergrundkampfes – oder im platten weltlichen Geheimdienstjargon ausgedrückt: Zersetzungsarbeit. Katholisch ausgedrückt: einfach nur Missionierung. Das konnte mir jetzt zwar völlig egal sein, aber wie unser Gehirn so spielt – es lässt sich nicht immer den strikten Tagesbefehlen unterordnen. Spätestens in einer der ruhigeren Momente setzt es sich mit seinen Erinnerungswünschen durch.
So auch jetzt, während wir noch eine halbe Stunde im schattigen Innenhof der Krankenhausanlage warten sollten. Mir ging die Auseinandersetzung zwischen den Katholiken in Westberlin durch den Kopf. Meine redaktionelle Mitarbeit an Dr. Duwes Streitzeitschrift »bundesdeutsche tabus« hatte viele informelle Kontakte zur Folge. So erhielt ich eines Tages eine völlig neu entstandene Zeitung auf den Schreibtisch. Sie hieß DIALOGIKUS – Christliche Monatszeitung.
In dieser christlichen Schrift gab es etwas revolutionär Neues: Eine mit der Chefredaktion gleichberechtigte Redaktion, die obendrein auch noch unabhängig von den Auflagen der Kirchenleitung arbeiten durfte. Es gab – Revolution! Revolution! – eine Leserversammlung, die mitbestimmen durfte, welche Themen bearbeitet wurden und – welch ein frevelhafter Bruch mit der Vergangenheit! – die aktive Mitarbeit des einfachen katholischen Fußvolkes jeglicher politischer Couleur war ausdrücklich erwünscht. Führten bislang nur äußerst CDU-treue, konservativ-etablierte Kreise das Wort in Kirchenzeitungen, so kamen nun auch andere Positionen – insbesondere sozialethische – zu Wort.
Das passte naturgemäß nicht ins festgezurrte Weltbild der beamteten Pfarrer und ihrer kirchlichen Vorgesetzten. So kam es zu Boykottaufrufen des Kirchen-Establishments gegenüber dem DIALOGIKUS . Doch steter Tropfen höhlt den Stein: Im Laufe der Auseinandersetzung und mit dem Wechsel des gesellschaftlichen Klimas konnten sich die progressiven Kräfte schließlich auch in kirchlichen Publikationen einen Standort – und damit zumindest Gehör – verschaffen. Die religiös verbrämte Maulkorbpolitik des Vatikans fand ein zaghaftes Ende.
Читать дальше