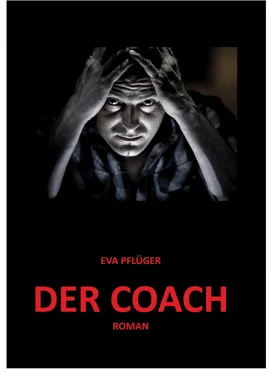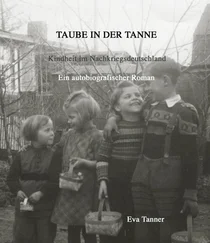Mit meinem Leben bin ich so zufrieden wie man es mit 58 Jahren und ohne Familie nur sein kann. Die paar Kilo zu viel, die bei meiner Größe nicht sonderlich auffallen, bewege ich mit großer Gelassenheit durch meine Welt. Auf andere wirkt das Tempo entweder beruhigend oder provozierend, das hängt vom jeweiligen Kontext ab. Die Frage eines Freundes, wie ich es schaffe, ständig den Eindruck zu erwecken, als wandle ich durch den Kreuzgang eines Klosters, während um mich herum das Leben tobt, kann ich nicht beantworten. Mein Tempo war immer schon so, egal ob ich mich morgens aus dem Bett quäle oder Gefahr laufe einen Zug zu verpassen.
Für gewöhnlich werde ich 10 Jahre jünger geschätzt. Außer dass es mein Ego bedient, bestärkt es mich darin, an der inzwischen weiß gewordenen Mähne im Trend der 70er Jahre festzuhalten. Die Haare in Hemdkragenlänge zu tragen ist aus der Mode, das ist mir bekannt. Und es ist mir gleichgültig. Es ist mir ebenso egal wie das Diktat der jeweils aktuellen Männermode oder der Kleiderordnung der Organisationen, in denen ich mein Geld verdiene. Es sind diese winzigen Nischen, die ich nutze, um einen Rest von Rebellion gegen das Diktat bürgerlicher Konventionen leben zu können.
Mir fällt ein Erlebnis aus den Anfängen meiner Karriere als Coach ein, das ich hin und wieder nach dem Genuss von Rotwein auch in Gesellschaft zum Besten gebe; aus der Reaktion der Zuhörer schließe ich, dass es einigen Unterhaltungswert hat. Damals hat der Vorfall für ein paar Stunden meine schwer zu erschütternde Balance gestört. Ein börsennotiertes Unternehmen war auf der Suche nach Coaches für sein Topmanagement und man hatte mich zu einem Probecoaching vor Publikum eingeladen. Das kam mir ungefähr so vor, als fordere ein einfallsloser Personalchef die erfahrene Bewerberin für einen Posten im Chefsekretariat auf, sich zu Testzwecken dem Diktat eines Geschäftsbriefes zu stellen. Ich war in meinem Lieblingsoutfit erschienen, schwarzer Anzug, schwarzes T-Shirt, eher eine Verkleidung, die Werbeleute als Erkennungszeichen für sich beanspruchen, aber ich fühle mich wohl darin, auch wenn ich nicht zu dieser Spezies gehöre. Die eleganten schwarzen Schnürschuhe waren mein Zugeständnis an die Zwänge der Businessmode. Sie sahen an diesem, und ich fürchte auch an jedem anderen Tag in meinem Leben aus, als habe ich in aller Eile versucht, ihnen mit Papiertaschentuch und Spucke zu etwas Glanz zu verhelfen. Meinen Schuhschrank füllt eine ganze Armada von bequemen Tretern. Nur die Tatsache, dass derartiges Schuhwerk bei meiner Klientel als Karrierebremse gilt, hält mich davon ab, auch bei geschäftlichen Anlässen die bequeme Variante zu wählen.
Zurück zu der Anekdote aus meinen Anfängen als Coach. Das Vorturnen vor den Managern des Daxunternehmens war hervorragend gelaufen. Noch nach Jahren erinnere ich mich an die sechs fahlgrauen Einreiher und die farbenfrohe Kopie eines Chanelkostüms auf langen Beinen, die mir als Coach allesamt hohe Kompetenz attestierten und daher umso mehr bedauerten, dass ich dem Topmanagement nicht zu vermitteln sei. Ich müsse verstehen, das lässige Outfit, die fehlende Krawatte. Mein Verständnis hatte sich in Grenzen gehalten. Hätte man mich um meine Einschätzung gebeten, was natürlich niemand tat, hätte ich die versammelten Leistungsträger darüber aufgeklärt, dass ich ihre Begründung für außerordentlich inkompetent hielt. Sie hatten den aufflackernden Zorn in meinen Augen nicht wahrgenommen, während ich jenes Haifischgrinsen erwiderte, das mir von der anderen Seite des Tisches entgegen blitzte und das ich so sehr verabscheute. Mit aufreizend langsamen Bewegungen hatte ich meine Papiere eingesammelt, in die Innentasche meines Mantels gestopft und den Saal mit ein paar höflichen Floskeln zum Abschied verlassen.
Während meine Gedanken an diesem Freitagabend weiter ungeordnet durch mein Hirn kreisen, muss ich, ohne es registriert zu haben, die Schreibtischlampe eingeschaltet, den Computer hochgefahren und Outlook gestartet haben. Außerdem ist die Rotweinflasche leer. Ich brauche Nachschub und etwas zu essen. Schlurfe wieder in die Küche und prüfe meine beachtlichen Weinbestände. Ich entscheide mich für einen Tempranillo, belade einen Teller mit Baguette und Käse sowie einem geschälten Apfel als Zugeständnis an eine wenigstens ansatzweise ausgewogene Ernährung.
Das alles trage ich zu meinem Schreibtisch, auf dem das gleiche Chaos herrscht wie augenblicklich in meinem Kopf. Der neugierige Betrachter kann unter der beständig wachsenden Papierflut die ganze Pracht des edlen, drei Meter breiten Empiremöbels nur erahnen. Das Chaos ist Ausdruck meiner unbezähmbaren Sucht, alles wissen und verstehen zu wollen. Besser zu sein als alle anderen.
Ein Blick auf den Outlook-Kalender lässt meine Befürchtung zur Gewissheit werden. Auf das Wochenende folgt wieder mal ein Montagnachmittag mit Mutter. Den Abend werde ich dann damit verbringen, den Abschlussreport für einen Klienten zu schreiben. Ich erinnere mich noch sehr präzise an dessen ersten Auftritt, obwohl seitdem mehr als 18 Monate vergangen sind.
Ein stark übergewichtiger Mann war mit raumgreifenden, zu allem entschlossenen Managerschritten, die vermutlich Entscheidungsfreude und Führungsanspruch signalisieren sollten, in meine Wohnung gestürmt. Obwohl er den Fahrstuhl in das dritte Obergeschoss genommen hatte, stand er nach Luft japsend vor mir. Er hatte sich telefonisch zu einem Vorgespräch angemeldet und teilte mir ohne Umwege über höfliche Konversation und mit seiner Kurzatmigkeit ringend mit, was der Grund seines Besuches sei. Er wolle seinen nächsten Karriereschritt in Angriff nehmen, wie er sich ausdrückte, und sich dabei von mir beraten lassen. Ich sei ihm empfohlen worden.
Hätte ich mich damals von meinem ersten Impuls und den wenig wertschätzenden Schlussfolgerungen leiten lassen, hätte der potenzielle Kunde, da bin ich sicher, dankend auf meine Dienste verzichtet. Wenn der Mann nicht bereit sein würde, seine Selbstwahrnehmung kritisch zu hinterfragen und in der Konsequenz seinen zweifellos ungesunden Lebensstil radikal zu ändern, wäre es mit der Karriere sehr schnell und vermutlich dauerhaft vorbei. Diese Gedanken behielt ich erst einmal für mich und besann mich auf meine Talente als empathischer Profi.
Die Geschichte, die ich zu hören bekam, nachdem der Besucher seine mehr als hundert Kilo zu meiner Verblüffung auf dem zierlichsten Stuhl platziert hatte, der in dem Coachingraum zu finden war, glich einem Parforceritt durch eine Welt gnadenloser Selbstausbeutung. Um die atemlose Jagd zu stoppen, nutzte ich eine Unterbrechung seines Vortrags, in der mein Besucher mit hochrotem Kopf nach Luft schnappte.
„Lassen Sie uns eine kurze Pause machen“, bat ich ihn, „ich denke, ein Wasser wäre jetzt gut.“
„Danke, ich brauche nichts.“
„Ich schon. Bin gleich wieder bei Ihnen.“
Er warf einen Blick auf seine Uhr. Ich ließ mir Zeit. Als ich mit einer Karaffe und Gläsern zurückkehrte, stand er am Fenster und starrte gebannt auf sein I-Phone. Noch ein Blick auf die Uhr, dann setzte er sich wieder, schaute mich mit einer steilen Unmutsfalte zwischen den Augen an. Ich betrachtete meinen Gast. Auftritte dieser Art gehörten so zuverlässig zum Standardrepertoire mancher gestresster Manager wie drittklassige Schauspieler in eine Daily Soap. In solchen Momenten fühlte ich mich stets ein wenig traurig, gleichzeitig waren sie die implizite Aufforderung an mich selbst, mich mit aller Aufmerksamkeit und Professionalität meinen Gesprächspartnern zuzuwenden.
Ich trank einen Schluck Wasser. Mein Besucher ergriff ebenfalls das Glas, das ich vor ihn hingestellt hatte und leerte es.
Читать дальше