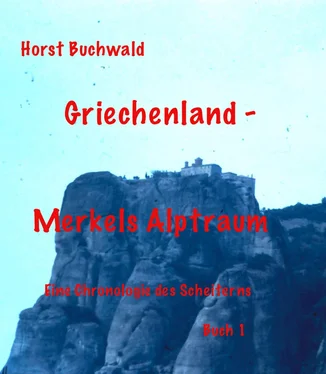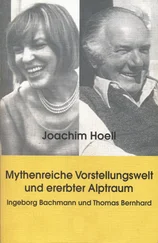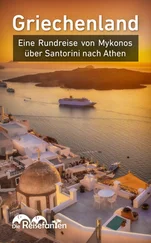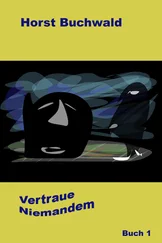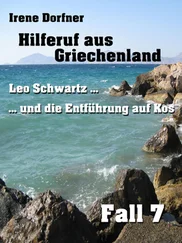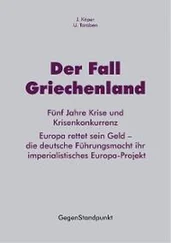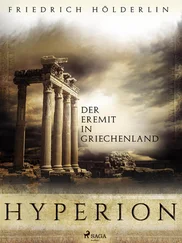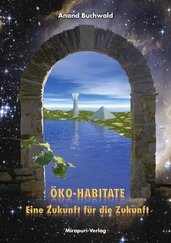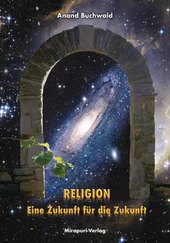Die Schuldentragfähigkeit
Wenn wir uns nun in die Lage eines Investors oder eines beliebigen Analysten einer Ratingagentur versetzen und fragen, welche Berechnungen er Anfang 2010 anstellen würde, um die Schuldentragfähigkeit und damit die Bonität Griechenlands beurteilen zu können – mit welchem Ergebnis hätte man rechnen müssen?
Er würde sich zunächst die Entwicklung der Staatsverschuldung vornehmen (Tabelle 1) und dabei eine rasche Zunahme seit Beginn der Finanzkrise in den USA feststellen. Nehmen wir an, bis 2015 würde die Quote auf 150 Prozent vom BIP ansteigen (Anmerkung: Das ist eine sehr moderate Steigerung!), dann wäre es sicher nicht vermessen, davon auszugehen, daß die Renditeaufschläge im Schnitt bei 6 Prozent liegen werden. Daraus ergibt sich ein Zinsendienst von 9 Prozent vom BIP (6x1,5), der aus dem Steueraufkommen beglichen werden muß. Damit eröffnet sich ein gewaltiges Problem, denn die Steuerquote lag in Griechenland bei 20 Prozent.
Okay, die Griechen könnten die Steuern ja erhöhen. Einfacher gesagt als getan. Denn allein um den Anstieg der Verschuldung von 100 auf 150 Prozent bei 6 Prozent bedienen zu können, müßte die Quote um mindestens 3 Prozent angehoben werden. Für die griechische Bevölkerung hätte das eine über viele Jahre erhebliche steuerliche Belastung bedeutet. Und dabei wäre nichts gewonnen, denn es werden ja lediglich die Zinsen für Altschulden gezahlt. Sofern die Verschuldung höher ausfällt, müßte die Belastung erneut gesteigert werden. Somit zeichnet sich ab, daß jede künftige Regierung in Athen mit erheblichen und zunehmenden Widerständen der Bevölkerung rechnen muß. Denn mit dem Zinsendienst und den Steuererhöhungen ist eine zunehmende Verarmung verbunden. Zugleich gelingt es dem Staat nicht, das Verschuldungsproblem loszuwerden.
„Wenn es hart auf hart kommt …“
Anfang 2010 stand also fest: Die Griechen waren pleite und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr entschulden. Das hat normalerweise zwei Folgen: Die Griechen setzen auf eine Umschuldung oder gehen in die Insolvenz. Aber das hat weitreichende Folgen für jene, die am stärksten betroffen sind. Und wen trifft es? Natürlich die Banken und private Investoren. Für sie wären Insolvenz oder Umschuldung/Entschuldung ein Desaster. Sie hatten sich mit griechischen Staatsanleihen vollgesogen und darauf spekuliert, daß die Statements der Ratingagenturen die Renditen weiter steigen lassen und sie weiterhin richtig Kasse machen konnten. Damit wäre es im Falle einer Insolvenz oder Umschuldung vorbei. Insolvenz bedeutet in der Regel: Sie verlieren so gut wie alles und bei einer Umschuldung müssen sie den Wert ihrer Anleihen abschreiben und in der Regel Verluste von 50 Prozent und mehr hinnehmen. Weil die Eigenkapiteldecke fast aller Banken damals zu dünn war, hätten zahlreiche europäische Banken um ihr Überleben fürchten müssen. Also setzte die mächtige Bankenlobby alles daran, dass nicht sie es sind, die die Folgen einer Pleite Griechenlands tragen müssen. Eine führende Rolle übernahm dabei die Deutsche Bank (s. unten).
Welche Strategie wählten die Banken? Wie schon in der US-Finanzkrise waren die Ratingagenturen ihre wichtigsten Partner. Ihr gemeinsames Ziel war: Die Steuerzahler der EU-Staaten sollten blechen. Verfolgen wir, wie sie dieses Spiel – also die Sozialisierung der Bankschulden – betrieben und letztlich auch gewannen.
Am 13.1.2010 schockte Moody’s die europäischen Regierungszentralen mit einer drastischen Aussage zur Verschuldungskrise der Griechen. Dem Land drohe ein „langsamer Tod“, denn die Hellenen müßten einen größeren Teil ihres Vermögens einsetzen, um Schulden abzustottern, während Investoren höhere Prämien dafür verlangen, dass sie griechische Anleihen halten. Moody’s bezog sich auf folgende Ausgangslage: Die Staatsschulden beliefen sich auf 125 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), während die Renditen auf zehnjährige griechische Staatsanleihen inzwischen auf 5,83 Prozent geklettert waren.
Die Aufforderung an die EU-Staaten, zu helfen, fiel nicht, doch die Botschaft war nicht zu übersehen. Und wie reagierte die EU-Elite samt der führenden Ökonomen? Wie nicht anders zu erwarten – die Antwort war wie bei einem gemischten Chor aus Gospel- und Opernsängern.
Um es vorwegzunehmen: Wenn die EU den Griechen helfen würde, bricht sie geltende Verträge. Ich habe es oben schon beschrieben: Die Bail-Out-Regelung wird außer Kraft gesetzt. Dem IW-Chef Hüther war das klar. Er war gegen Hilfen und darum betonte er, daß souveräne Nationalstaaten auch als Teil einer Währungsunion verpflichtet seien, „autonom für ihre finanzpolitische Situation Sorge zu tragen.“ Die Bail-Out-Regelung folge diesem Grundsatz und solle daher vor falschen Anreizen bewahren. „Eine Solidarhaftung darf es nicht geben.“ Ähnlich verhalte es sich mit einem Insolvenzverfahren: „Eine Insolvenzordnung für Staaten, die abschätzbar einen Hair-Cut organisiert, würde letztlich in gleicher Weise wirken und die Staaten zu anhaltender Disziplinlosigkeit verleiten.“
Auch der Bund der Steuerzahler wandte sich entschieden gegen Hilfen für Griechenland. Verbandsgeschäftsführer Reiner Holznagel verlangte, daß „Länder wie Griechenland schleunigst ihre Finanzpolitik ordnen müssen, statt klammheimlich auf ausländische Hilfe zu setzen.“ Außerdem stellte er klar: „Eine Haftung deutscher Steuerzahler darf es nicht geben.“
Der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, hielt dagegen ein Eingreifen der EU für unausweichlich. Ausgesprochen kontraproduktiv wäre es aus seiner Sicht allerdings, wenn in der derzeitigen Situation ein staatliches Insolvenzverfahren etabliert würde. Die Märkte würden das als Indikator dafür sehen, dass eine Insolvenz offenbar unmittelbar bevor stünde. „Dies würde eine Panikwelle mit unübersehbaren Folgen für den europäischen und globalen Zahlungsverkehr in Gang setzen“, erläuterte Horn. Auch langfristig sei dieses Instrument „keine Option“, da eine staatliche Insolvenz eines Mitgliedstaates immer Rückwirkung auf die anderen hätte. „Insofern führt kein Weg an einer gemeinschaftlichen Lösung vorbei“, betonte Horn. „No-Bail-Out ist eine Fiktion.“
Die Bundesregierung spielte weiterhin auf „cool“. Bundesfinanzminister Schäuble und Bundesbankchef Weber sprachen sich gegen Hilfen aus und setzten die Griechen mit dem Ziel unter Druck: Ihr müßt es aus eigener Kraft schaffen!
Griechen entdecken ökonomisches Zaubermittel
Am 19. Januar 2010 trafen sich die EU-Finanzminister und nahmen den Schuldensünder Griechenland in den Schwitzkasten. Das Verhandlungsergebnis lag voll auf der Linie, die Schäuble und Weber vorgegeben hatten. Die Griechen versprachen, bis Ende Januar werde man ein Stabilitätsprogramm in Brüssel vorstellen. Dann folgte die Sensation: Athen hatte sich Außergewöhnliches vorgenommen. Erstens: Im laufenden Jahr werde das Staatsdefizit auf 8,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) heruntergeschraubt. Zweitens: 2013 werde der Haushalt EU-konform sein – also ein Defizit von unter drei Prozent des BIP ausweisen.
Man reibt sich die Augen und fragt sich: Haben die Griechen ökonomische Zaubertricks entdeckt, die bisher niemand kannte? War es möglich, daß auch nur einer der EU-Finanzminister glaubte, die Griechen könnten diese Ziele erreichen? Oder war das nur Augenwischerei für die europäischen Steuerzahler? Genau das war es. Den Europäern wurde signalisiert: Keine Panik – in einem überschaubaren Zeitraum von drei Jahren haben die Griechen ihr Verschuldungsproblem gelöst – und das aus eigenen Kräften. Ihr, die europäischen Steuerzahler, werdet nicht zur Kasse gebeten und Verträge werden ebenfalls nicht gebrochen.
Читать дальше