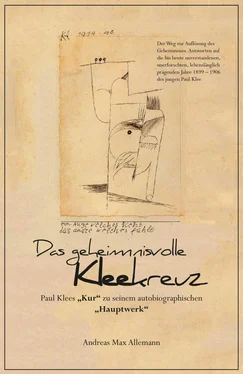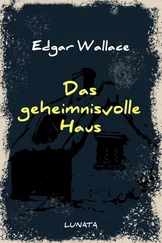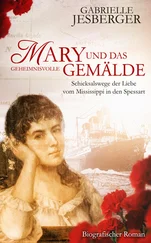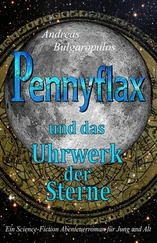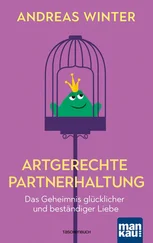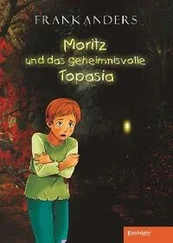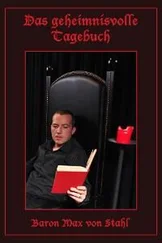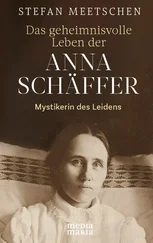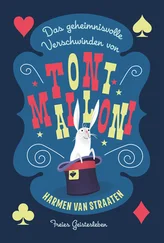„C: Sie wünschen? Eine Glaskugel ! Wie gross ? Vielleicht in Vollmondgrösse ! (Gegenseitiges verstehendes Lächeln).“
Eine geschlossene Glaskugel ist in den allermeisten Fällen eine Lampe, ein Leuchtkörper. In „Vollmondgrösse“ würde einen riesigen Leuchtkörper ausmachen und zwar von ungeahnter Leuchtkraft. Der Vollmond ist die Stellung des Mondes in grösster Opposition zur Sonne. Der Vollmond erreicht die maximale Helligkeit und beleuchtet die Erde um etwa das zehnfache. Die Erde ist bei Vollmond etwa 250-mal heller als bei einem sonstigen Nachthimmel. Paul Klees „möchte über das Pathos hinaus die Bewegung ordnen.“ Dazu bräuchte er eine immense Erhellung, eine Erleuchtung seines Geistes.
Im Vergleich zum Vollmond ist das Sonnenlicht etwa 400‘000-mal so hell.
Denken wir an die vielen Vollmonde oder Sonnen die sich in Klees Bildern farblich unterscheiden. Dabei handelt es sich nicht um blosse Darstellungen sondern um Erhellungen. Die Farbgebung macht den Sinn aus; auf der Palette von hellstrahlend bis verschwommen und getrübt.
943 „Die Genesis als formale Bewegung ist das wesentliche am Werk. Am Anfang das Motiv, Einschaltung der Energie, Sperma. Werke als Formbildung im materiellen Sinne: urweiblich.
Werke als formbestimmendes Sperma: urmännlich.
Meine Zeichnung gehört ins männliche Gebiet.“
944 „Formbildung ist energisch abgeschwächt gegenüber Formbestimmung. Letzte Folge beider Arten von Formung ist die Form. Von den Wegen zum Ziel. Von der Handlung zum Perfektum. Vom eigentlichen Lebendigen zum Zuständlichen.
Im Anfang die männliche Spezialität des energischen Anstosses. Dann das fleischliche Wachsen des Eies.
Oder: Zuerst der leuchtende Blitz, dann die regnende Wolke. Wo ist der Geist am reinsten? Im Anfang. Hie Werk, das wird (zweiteilig). Hie Werk, das ist.“
Im 943 und 944 beschreibt Paul Klee die Entstehung des Werkes in biologischer Anschauung eines Fortpflanzungsaktes. „Genesis“ verstanden als von der Zeugung bis zur Geburt. Zur Zeugung braucht es ein „Motiv.“ Die Bewegung, erzeugt („Energie“ „Sperma“) Samen. Der Same macht die Formbestimmung möglich, ist „urmännlich.“
P. Klee sieht sein Werk und daraus folgernd, die Werke als Formbestimmung. Somit verstehen wir die grundsätzlichen methodischen Ansätze seiner Kunstauffassung. Der „oberste Kreis“ ist die Formbestimmung, die Idee. Und die Idee, letztlich, das Geheimnis aus dem Innersten kommend, lässt erst die Formgebungen im graphischen Sinne zu. Im „obersten Kreis“ (Schöpferische Konfession), am „Anfang“ ist „der Geist am reinsten.“
943 beschliesst er bestimmend und explizite im Singular:
[…] „Meine Zeichnung gehört ins männliche Gebiet.“ […]
Paul Klee bezieht sich mit diesem Notat auf das (Titel)bild als Um- und Nachformung des Tafelbildes. Das Geheimnis in seinem Sinngehalt verdeutlicht er hingegen unumwunden. Seine „Zeichnung“ handelt: „Vom eigentlichen Lebendigen zum Zuständlichen.“
945 „Meine kristallklare Seite war je da und dort hochgetrübt, meine Türme manchmal bewölkt. Pein setzt sich zur Liebe, und ohne Sehnsucht 314 kann ich nicht lang noch kurz leben.“
Italien
314 „7.12.1901 Es reisen zwei Briefe und zwei Karten nach Norden, die eine Antwort nicht voraussetzen. Ich will die meisten Fäden, die mich mit früher verbinden, durchschnitten wissen. Vielleicht sind es Anzeichen einer beginnenden Meisterschaft. Ich trenne mich, von denen ich lernte. Undank der Schüler. Was bleibt mir dann? Nur Zukunft. Ich stelle mich gewaltsam drauf ein. Viele Freunde hatte ich nicht, wenn ich geistige Freundschaft fordere, bin ich fast verlassen. Zu Bloesch hat ich noch Vertrauen. Lotmar hat grosse Chancen, mit Haller stehe ich eigen. Wir passen nicht zusammen. Eine gewisse ehrenhafte Feinheit des Handelns werden wir uns wohl stets gegenseitig zutrauen. Enger sind wir nicht verbunden, waren wir vielleicht nicht. Ein ziemlich primitiver Mensch ist er, kann sich leicht sammeln und ganz sein. Lässt sich überblicken. Ich nicht. Bei so grosser Verschiedenheit wären wir ohne das gemeinsame Studium nie zusammengekommen. Ich kenne ihn seit seinem sechsten Jahr, und doch machten wir erst Gebrauch voneinander, als er ein oder zwei Jahre vor der Matura Maler werden wollte. Er näherte sich mir damals und schloss sich bei Landschaftsjagden an. Brack ist wertvoll, aber zwischen uns stehen jetzt noch Schranken. Leider muss man mit den Launen und Marotten dieses Originals stets rechnen. Manchen ganz guten Freund will ich gerne entbehren. Mein Lehrer Jahn ist mehr väterlichen Charakters.
Mit weiblicher Freundschaft will ich nichts mehr zu tun haben.“
946 „Traum: Ich finde mein Haus: leer, ausgetrunken den Wein, abgegraben den Strom. Entwendet mein Nacktes; gelöscht die Grabinschrift. Weisse.“
Im 945 beginnen wir den Zusammenhang zu erkennen, was er mit Erleuchtung und Erhellung seines Geistes ausdrückte. „Meine kristallklare Seite war da und dort hochgetrübt“ […]
Kristallklar ist ein stark glänzendes, meist geschliffenes Glas (von bestimmter chemischer Zusammensetzung).
Wenn -da kommt die Glaskugel aus dem lustigen Rätsel wieder- das Glas, der Mond oder gar die Sonne getrübt ist, wird eine gründliche Reinigung nötig, damit das Licht, der Geist wieder in voller Helligkeit strahlend, leuchten kann.
Diese notwendige Reinigung und die Gründe dazu beschreibt Klee im 945 „Pein setzt sich zur Liebe.“ Pein ist ein heftiges seelisches Unbehagen; etwas Quälendes.
Da sich die Pein zur Liebe setzt und die Liebe seiner Frau Lily gehört, hat das Quälende und das Bedürfnis nach Reinigung vor seiner Bekanntschaft mit Lily, vor 1901 stattgefunden.
Im 314 befand er sich mitten in seinem Läuterungs- und Reinigungsprozess.
Einige Autoren von biografischen Interpretationen haben als Folge dieser selbst gewählten Veränderung eine gewisse Vereinsamung festgestellt, was Paul Klee selbst befürchtete. Der Grund für die Einsamkeit ist, wie wir im 314 feststellten, in der mangelhaften intellektuellen und geistigen Entwicklung seines Umfeldes zu finden. [...] „314 Viele Freunde hatte ich nicht, wenn ich geistige Freundschaft fordere, bin ich fast verlassen.“ [...]
947 „Töne aus der Ferne. Ein Freund früh am Morgen hinter dem Berg. Hörnerklang, Smaragden.
U. Es ruft mich Gedanken zu, Kuss sich ahnender Seelen verheissend.
O. Es verband uns ein Stern, sein Auge fand uns: Zwei Ich als Gehalt; mehr denn als Gefäss. Heilige Steine gestern, heute rätsellos, heute Sinn!:
Ein Freund früh am Morgen hinter dem Berg.“
Der 947 lohnt eines tieferen Nachdenkens. Das schöne und gehaltvolle Gedicht unterteilt er typographisch, nicht wie üblich, durch Alinea (Absatzzeichen), nicht alphabetisch oder nummerisch sondern mittels den Vokalen U und O. Trotzdem, (meine persönliche Meinung und ohne jemanden nahezutreten) mich die Deutungen von Buchstaben nicht sonderlich überzeugen, sind viele Versuche bekannt.
O: Als Zeichen des Allumfassenden, als Anerkennung der göttlichen Gesetze, als geschlossener Kreis, als Einheit, als Vollendung und Vollkommenheit und wird musikalisch mit dem Grundton der Tonleiter, dem C gleichgesetzt.
U: Als höchste Erkenntnis eines Kerns, als Inspiration, als Erlösung, als Nähe zur Wahrheit, durch die Öffnung als Trichter des von oben Gesandten.
Ich überlasse jedem Leser eine Wertung des Gedichtes in Bezug auf die Vokale.
Wesentlicher ist die Tatsache, Paul Klee macht im 947, im Zusammenhang mit dem (Titel)bild erstmals einen rückblickenden Bezug auf ein Werk, als Folge und Konsequenz auf das ihn traumatisierende Ereignis:
„Zwei Ich als Gehalt;“
Die damaligen zwei Ichs in der Persönlichkeit Klees hatte eine schmerzhaft empfundene Folge, die letztlich den Kampf auslöste. Trotzdem empfand er 1914 das entstandene Resultat, das aus den beiden Ichs Hervorgegangene (aus dem Erleben des sexuellen Mysteriums, mit Schwangerschaftsfolge), als Smaragd, als heiligen Stern, als Sinn. So gesehen sind die beiden Ichs nicht Feinde sondern Freunde. Der Smaragd, ein Kristall, ein Edelstein tiefgrüner Färbung gilt seit Jahrhunderten als edelstes kristallines Gebilde.
Читать дальше