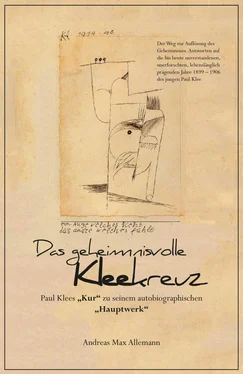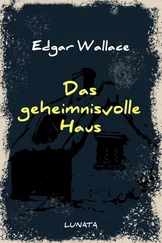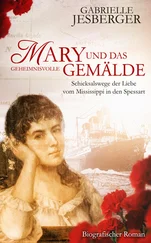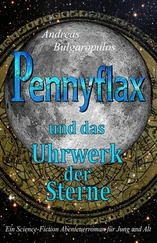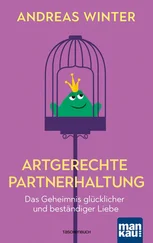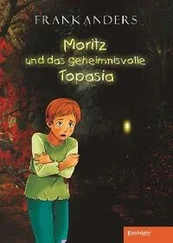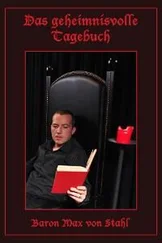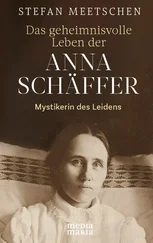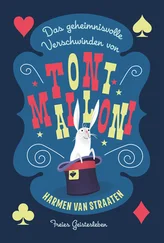Die Striche sind doppeldeutig. Einesteils, wie wir in „Schöpferische Konfession“ sahen, markiert er die Bewegung, ausgehend und endend mit einem Punkt. Nach Klees Auffassung ist der Punkt der Ursprung; quasi der archimedische Punkt aller graphischen Darstellungen, der Schöpfung. Andernteils ist er Hinweis auf die Verwandtschaft des Bildes mit einem Tafelbild.
Ein Tafelbild ist ein Gemälde auf flachem festen Material wie Holz. Das Malbrett gilt als Tafelbild im eigentlichen Sinne, Bild auf Holz.
P. Klee arbeitete 1902 nachweislich an einem Tafelbild. Im Abschnitt 459 schreibt er:
„Dann und wann begeb ich mich wieder ans kleine Tafelbild“ […]
Bei Klees Werken begegnen wir sehr vielen Tafelbildern, die hinweisend gekennzeichnet sind durch Unterstriche.
Wir kehren zurück zur regen Diskussion über die Emblematik, wo man im Extremen die Meinung vertrat, um die Rätselhaftigkeit, das Geheimnis zu bewahren, sollen keine vollständigen Körper sondern nur Teile oder Fragmente gezeigt werden. Dies ist die eine Seite dieser Bildbetrachtung. Die andere heisst Reduktion, im Sinne einer Klee-typischen Vorliebe, zur Abstraktion.
Er schreibt im Abschnitt 425, am 22.6.1902:
425 „Was mir ehemals fremd, dies verstandesmässige Behandeln in meinem Beruf, beginne ich in der Not nun doch besser, wenigstens versuchsweise. Ich werde scheinbar ganz klein und nüchtern, ganz undichterisch und ganz schwunglos. Denke mir ein ganz kleines Formmotiv aus und versuche die knappe Darstellung; natürlich nicht in Stationen, sondern in Praxis, das heisst mit einem Bleistift bewaffnet. Es wird wenigstens eine veritable Handlung und aus wiederholten kleinen Taten wird einmal mehr als aus dichterischem Schwung, ohne Form, ohne Gestaltung. Ich bin immer zu mit dem nackten Körper beschäftigt, der sich hierzu eben eignet. Ich projiziere auf die Fläche, das heisst, das Wesentliche muss immer sichtbar werden, auch wenn es in der Natur, die auf diesen Reliefstil nicht eingestellt ist, unmöglich wäre. Dabei spielt auch die Verkürzungslosigkeit eine wesentliche Rolle. Es ist klein, eng beieinander, aber es ist nun wenigstens eine reelle Tätigkeit. Ich lerne ganz von vorn, ich beginne zu formen, als ob ich nichts wüsste von oiler Malerei. Denn ich habe ein ganz kleines unbestrittenes Eigentum entdeckt: eine besondere Art der dreidimensionalen Darstellung auf der Fläche. Und abends kann ich mich hinlegen mit dem Bewusstsein einer getanen Arbeit. Das ist auch etwas. Ein fliegender Mensch! Hereindenke die dritte Dimension in die Fläche. Armstellungen, Beindoubletten. Verkürzungslosigkeit.“
Was er mit der […] „dreidimensionalen Darstellung auf der Fläche“ […] aussagen will, werden wir später feststellen und setzen die Betrachtung des (Titel)bildes fort.
Am oberen linken Bildrand sehen wir die Identifikation des Schöpfers, reduziert auf den grossgeschriebenen K und den Kleinbuchstabe l, er datierte es mit „1914“ und mit der Zahl .100. zwischen zwei Punkten4.
Diese Zahl ist ein versteckter Hinweis.
Klee formulierte 1920 in der „Tribune der Kunst und Zeit“ in seinem Beitrag unter I
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Das Wesen der Graphik verführt leicht und mit Recht zur Abstraktion. Schemen- und Märchenhaftigkeit des imaginären Charakters ist gegeben und äussert sich zugleich mit grosser Präzision. Je reiner die graphische Arbeit, das heisst, je mehr Gewicht auf der graphischen Darstellung zu Grunde liegenden Formelemente gelegt ist, desto mangelhafter die Rüstung zur realistischen Darstellung sichtbarer Dinge.
Formelemente der Graphik sind: Punkte, lineare, flächige und räumliche Energien.“ […]
Schauen wir uns jetzt die abgebildeten Formen oder Formfragmente an: Dabei erinnere ich mich an Klees Frage.
„Entsteht vielleicht ein Bildwerk auf einmal? Nein es wird Stück für Stück aufgebaut, nicht anders als ein Haus. Und der Beschauer, wird er auf einmal fertig mit dem Werk? (Leider oft ja) Sagt nicht Feuerbach, zum Verstehen eines Bildes gehöre ein Stuhl? Wozu ein Stuhl? Damit die ermüdenden Beine den Geist nicht stören. Beine werden müde vom langen Stehen. Also Spielraum: Zeit.“
P. Klee in „Schöpferische Konfession“ 1920
oder:
München November 1913
921 „Gegensätze im kleinen kompositionell verbinden, aber auch Gegensätze im grossen, zum Beispiel: Ordnung dem Chaos gegenüberstellen; so dass beide an sich zusammenhängende Gruppen neben- oder übereinander gestellt in Beziehung zueinander treten; in die Beziehung des Gegensatzes, wodurch die Charaktere hüben und drüben gegenseitig gesteigert werden. Ob ich so etwas jetzt schon kann, ist nach der positiven Seite fraglich, negativ leider mehr als fraglich. Aber der innere Bedarf wäre da. Dann wird das Können sich schon bereiten.“
Ein knappes halbes Jahr später, unmittelbar nach der „Studienreise nach Tunesien“ ist es ihm gelungen.
Beginnen wir mit dem Sehen von oben nach unten, sitzend können wir uns ja die nötige Zeit gönnen.
Auf einer horizontalen Linie, Platte oder Deckel stehen drei vertikale kleine Linien mit je einem markanten Punkt, eine Dreiheit anzeigend. Darunter und wie es scheint, von dieser Platte verschlossen, ein Gefäss, Kessel, Korb, oder Kanne mit Ausguss rechts. Darin ein Gebilde, das eine herzförmige Darstellung ausmacht. Das grösste Rätsel stellt die Zweiheit des Kopfes dar. Die beiden Gesichtshälften zeigen deutlich zwei verschiedenartige Köpfe, mit dem senkrechten schrägen Strich und -die linke Hälfte ist gar eingerahmt-, der unterschiedlichen Physiognomie, wo man einen Altersunterschied zwischen den beiden Gesichtshälften erahnt. Beide Hälften verfügen über je ein Auge, wobei das linke offen und das rechte durch das Augenlid mit den markanten Wimpern als geschlossen anmutet. Es kann sein, durch den Fingerzeig, dieses Auge sieht hinunter und Lid und Wimper lassen das Auge aus unserer Perspektive als nicht sehend ausmachen.
Die Haarpartie der linken Gesichtshälfte besteht aus 3 einzelnen, zur Höhe stehenden Haaren und aus zwei deutlich kreuzförmig angeordneten Haarbüscheln. Auf der rechten Hälfte sehen wir gegenteilig, wohlgeordnete Haare. Die Augen beider Gesichtshälften sehen oder fühlen ein Gebilde, das an der Trennlinie beginnend, von oben nach unten anmutet, wie aus einer Einheit eine Zweiheit wird; wie aus einem Bauchteil zwei Beine herunterhängen. Gemessen an der Grösse der beiden Gesichtshälften muss es sich bei den Beinen um Beinchen handeln. Die unterschiedlichen Gesichtshälften und das hinabhängende Beinchenpaar bestätigen die auf dem obersten Strich angezeigte Dreiheit, jetzt im Zentrum des Werkes. Das rechte Auge sieht oder fühlt, durch den dominanten Fingerzeig unterstützt, auf etwas Fliessendes. Das Fliessende (Wasser) strömt aus dem Ausguss des Gefässes, erscheint auf der linken Seite, unter den beiden Gesichtshälften wieder, ergiesst sich kaskadenartig gegen den Bildrand rechts und versickert. Erstaunlich, nicht unabsichtlich ist der unterste Teil des Trennstriches der beiden Gesichtshälften, der fächerartig endet. Das ganze Blatt ist leicht koloriert, ocker, mit schwarzem Stift und leichten hellen Rottönen.
Bis jetzt haben wir, der Methode von Edwin Panofski vertrauend; die Tatsachen und die formalen, motivischen, künstlerischen Bildinhalte aufgezählt. Um weitere Erkenntnisqualitäten zu erlangen, werden wir die literarischen Quellen studieren müssen. Machen wir uns auf den Weg:
Wir finden im 937 „Ein Auge welches sieht, das andre welches fühlt“, den Eintrag unmittelbar nach seiner Rückkehr von der Tunesienreise im April 1914. Ob Paul Klee in der handschriftlichen Tagebuch-Fassung welches oder welch es notierte kann ich nicht exakt bestimmen, Felix Klee schrieb welches.
Auf der Bild- Beschriftung ist „welch es“ klar lesbar.
Читать дальше