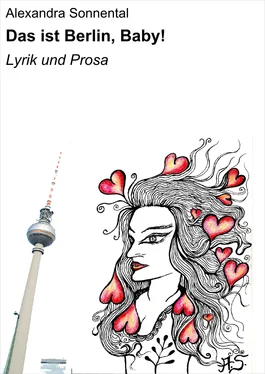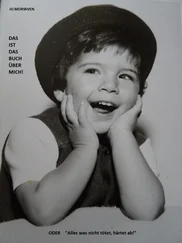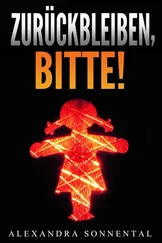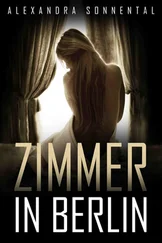Eines Abends, als ich in einem Gaukler-Lokal im Herzen der Stadt meine Dichtkunst vortrug, passierte es. Johanna schritt nach der Lesung wie aus dem Nichts auf mein Lektorenpult zu und glitt ohne ein Wort in meine Arme. Zuerst versuchte ich, das tollkühne Weib von mir zu stoßen, doch die Küsse von ihren rot bemalten Lippen raubten mir in Sekundenschnelle den Verstand. Halb zog sie mich, halb sank ich hin , wie schon der große Dichterfürst Goethe wusste. Ohne dass ich auch nur einen einzigen Tropfen Wein intus hatte, trieben mich ihre Küsse gepaart mit dem Duft der Schlange in die Trunkenheit. Entgegen meiner Prinzipien, die besagten, die leibhaftige Johanna aus meinem Leben zu verbannen, wollte ich sie besitzen und mit dem Feuer meiner Lenden versengen, auch wenn sie dafür mit weiteren Rippenbrüchen bezahlen müsste. Sie umfing mich mit den Armen einer Schlingpflanze und schien niemanden außer meiner Wenigkeit zu sehen. Als sie sich jedoch zum Ausschank begab, um ihre Kehle mit Schnaps zu befeuchten, nahm mich mein Dichterfreund Heinrich zur Seite und sprach: „Hüte dich vor diesem liederlichen Frauenzimmer! Die schwarze Johanna ist in unseren Kreisen bekannt wie ein bunter Hund. Sie bezirzt die Mannsbilder so meisterhaft wie sie malt. Wenn du sie liebst, bist du verloren. Johanna hat ein Herz aus Stein, die Nase voll Opium und die Adern voll Schnaps.“
„Vielleicht liebt sie mich entgegen all ihrer Gesetze“, erwiderte ich.
„Ja, zwischen ihren lasterhaften Schenkeln!“, rief Heinrich und brach in schallendes Gelächter aus.
Ich war kurz davor, Heinrich den Ellenbogen in den Magen zu rammen, doch bevor ich dazu kam, hing mir das Objekt meiner Begierde wieder an den Lippen.
„Hast du schon Bekanntschaft mit meinem Herzbuben gemacht, liebster Heinrich?“, fragte sie ihn und legte ihre Hand auf seine Schulter. Er schubste sie sofort weg.
„Pah, wo hast du denn ein Herz, elende Ratte!“, zischte Heinrich sie an.
Verärgert bäumte ich mich vor ihm auf und zügelte mich, ihm ins Gesicht zu brüllen. Mit gedämpftem, aber bestimmt klingendem Ton stellte ich unmissverständlich klar: „Wer hier mein Mädchen beleidigt, bekommt beim nächsten Versuch meine Fäuste zu spüren, mein Freund. Merke es dir gut!“
„Wenn du glaubst, Johanna wäre dein Mädchen, dann wünsche ich dir Glück, dass du von weiterem Schaden verschon bleibst. Bis jetzt klebt nur ihr Lippenrot in deiner Visage, doch bald schon könnte es dein eigenes Blut sein“, seufzte Heinrich, während er mich eindringlich ansah, und einen Augenblick später ohne ein weiteres Wort von dannen zog.
Johanna lachte mit der Hysterie einer Hexe. „Dem Heinrich ist wohl der Wein zu Kopfe gestiegen!“, gluckste sie an meinen Schultern hängend.
„Lassen wir ihn“, entschied ich, „trinken wir auf die Kunst und die Liebe!“
„Auf die Malerei und die Lust!“, rief Johanna quer durchs Lokal, erhob ihr Glas und berauschte sich an dem Inhalt. Ich konnte mir nicht helfen und tat es ihr gleich.
Als wir richtig volltrunken waren, verzogen wir uns Hand in Hand aus der Spelunke. Wir stürzten uns am Spree-Ufer in den Schlamm, das schwarze Tuch des nächtlichen Himmels bedeckte unsere entblößten Leiber. In jener Nacht drang ich in Johanna mit dem Feuer meiner Lenden ein. Gut zwei Monate waren ins Land gestrichen, die Zeit hatte ihre geschundenen Rippen wieder zusammenwachsen lassen. Aufs Neue schrie sie unter mir, doch diesmal vor Lust und Wohlgefallen. Ich dagegen grölte stumm „Ich liebe dich“, wohl wissend, dass die drei Worte ihr Verlangen nach mir für immer töten würden. Mein Freund Heinrich hatte wahre, wohlgemeinte Worte gesprochen und ich gaukelte mir selbst vor, dass es genüge, wenn wir uns nur zwischen den Schenkeln liebten.
Nachdem wir im Morgengrauen auf getrennten Wegen heimwärts gegangen waren, schwappte eine neue Welle aufbrausender Worte durch mein Dichterhirn. Plötzlich schwante mir ein Ziel vor Augen: Ich wollte endlich meinen eigenen Gedichtband veröffentlichen und die Verse mit Johannas Bildwerk verzieren. So würden wir auf ewig in der Kunst verbunden sein. Umgehend eilte ich zu ihrer Hütte nach Rixdorf, wo ich Johanna in einem benebelten Zustand vorfand. Aus geweiteten Pupillen starrte sie fast wie versteinert auf die Leinwand vor ihrer Nase. Sie rührte sich nicht, sondern fixierte das gruselige Puppengesicht ihrer malerischen Einbindungskraft. Anstelle von Augen hatte die Fratze schwarze Höhlen und ein weit aufgerissenes Maul mit waberndem Schlund. Sepia-Töne verliehen dem Werk eine alptraumhafte Note. Johanna liebte diese Farbgebung. Nur ihre Tochter Ernestine hatte sie in warmen, lebendigen Nuancen porträtiert. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter und beäugte das Kunstwerk auf der Staffelei. Johanna genoss es, wenn ich ihre Gemälde würdigte und faselte: „Wie gefiele dir eine Ratte, die einen Phallus verschlingt?“
Innerlich schockiert holte ich aus zur Gegenfrage: „Wie gefiele dir ein Gedichtband mit deinen Illustrationen?“
Ihr hysterisches Lachen sowie die Antwort aus ihrem Munde sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben: „Perfekt, mein Lieber! Dann könntest du dir gewiss sein, dass das Volk endlich deine Verse liest.“
Ehe ich mir Gedanken machen konnte, ob ich mich über diese Worte freuen oder ärgern sollte, sprang Johanna von ihrem Schemel auf und rief: „Ja, das ist die Idee! Folge mir nach draußen auf die Wiese. Da werde ich dich mit meinen Buntstiften abbilden.“
Mit solch überschwänglicher Begeisterung hatte ich nicht gerechnet, denn ihr Zustand wechselte prompt von apathischem Dasitzen zu manischer Euphorie. Sie sammelte ihre Zeichenutensilien zusammen, packte mich beim Arm und riss mich mit sich vor die Tür.
Wir spazierten eine Weile nebeneinander her und Johanna erzählte mir: „Einst zeichnete ich meinen fahrenden Fuselhändler auf der grünen Sommerwiese. Dann liebten wir uns bis zum Einbruch der Dunkelheit und badeten bei Vollmond wie Gott uns schuf im See. Das taten wir so manches Mal und die Zeit konnte schöner kaum sein. Eines Tages verließ er mich. Mich armes, einsames Weib!“
Kaum hatte sie angefangen, über ihr Los zu lamentieren, verwandelte sich ihr ebenmäßiges Gesicht in die Fratze auf ihrer Leinwand daheim. Tränen kullerten über ihre Wangen, welche ich nun einfach nur küssen wollte. Ich schloss sie in meine Arme und sie heulte sich an meiner Schulter die Augen aus.
„Er hat mich verlassen, der Schuft!“, schluchzte sie. „Einfach so fortgegangen mit einem anderen Weib!“
„Beruhige dich, nun bin ich ja da“, tröstete ich sie und strich über ihre langen schwarzen Haare.
Nun wurde mir auch klar, warum es ihr so schwer fiel, meine Liebe zu erwidern. Johanna erinnerte mich an ein kleines verletztes Tier, das sich fürchtete. Auf einmal löste sie sich mit einem Ruck aus meiner Umarmung und riss mir dabei das Hemd fort. Die Knöpfe sprangen von ihren Fäden und rieselten ins Gras vor unsere Füße. Ich fühlte mich wie elektrisiert von diesem Sinneswandel. Noch immer rannen Tränen über ihre Wangen, aber ihren Mund zerrte sie bereits für ein lautes Lachen in die Breite. Ihr Gelächter steckte an, mitunter lachten wir wie aus einer Kehle.
„Beweg dich nicht! Bleib so! Nein, posier ein bisschen. Wie ein Dichter!“, wies Johanna mich an.
Sie hatte vor, mich zu zeichnen, während ich schrieb. Selten verließ ich meine Kammer ohne Kladde nebst Griffel und trug die Schreibutensilien auch an jenem Nachmittag bei mir. Johanna suchte sich ein paar Ellen von mir entfernt einen Platz, wo sie mich gut beobachten konnte. Sie vertiefte sich in ihre Zeichnung und schaute immer wieder von ihrem Papier auf. Während in meiner Pose die Worte nur so aus mir herausströmten, wäre ich vor Liebeshitze fast gestorben. Es erregte mich, dass auf ihrem Block meine Konturen durch ihren Stift geformt wurden. Ja, sie steuerte freiwillig ihren Beitrag zu unserer Vereinigung in der Kunst bei. Zusammen könnten wir große Werke erschaffen, glaubte ich felsenfest. Mein Blick schweifte unentwegt zwischen meiner Schreiberei und der zeichnenden Johanna hin und her. Ich fixierte ihr Gesicht, das sowohl von Emsigkeit als auch von Erschöpfung geprägt war. Auf dem Papier in Vorfreude taumelnd, fantasierte ich, wie ich mich nach der Zeichenstunde vor Fuchs und Hase mit meiner Muse verlustieren würde. Verbrennen wir das Gras mit dem Feuer unserer Leiber , schrieb ich, und was auf dem Papier stand, das taten wir dann auch. Zuerst aber erhob sich Johanna mit ihrem Werk, schritt auf mich zu und stachelte mich an, sie für die Zeichnung zu loben.
Читать дальше