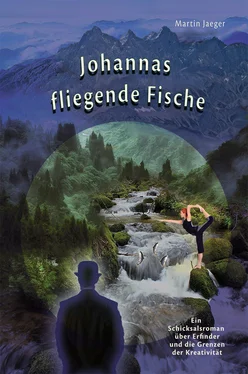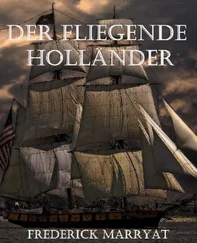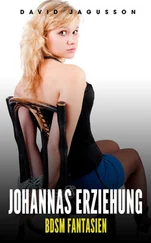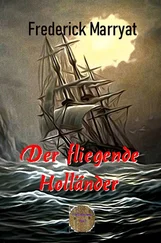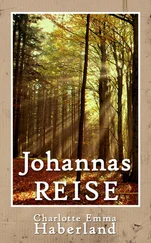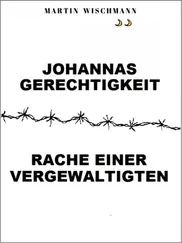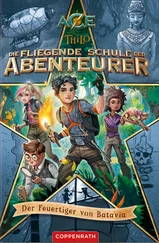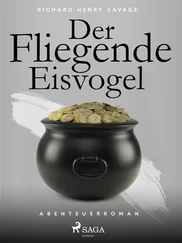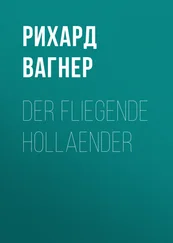Vorn im Bus hocken Touristengruppen; Deutsche, Amerikaner und Japaner, die sich ungewöhnlich manierlich benehmen. Sie unterhalten sich gedämpft, versuchen mit geringem Geschick, wie bei einem Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt, ihre Körper den schlingernden Bewegungen des Transporters anzugleichen. Der Fahrer befährt Steigungen und Senken, breite wie schmale Straßen, mit derselben Gelassenheit, pumpt geschickt auf der ächzenden Kupplung herum, die sich immer nur in den Abfahrten ihrer Blähungen entledigen kann. Die neue Generation von Bussen wird bald kommen, freut sich der Fahrzeugführer, um sogleich wieder schnarrend die Ratschenbremsen zu betätigen, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Insbesondere in scharfen Kurven purzeln die Fahrgäste durcheinander wie die Kegel.
Heute hat sich ein Einheimischer zwischen die Touristen gemischt. Ganz hinten links in der vorletzten Reihe am Fenster sitzt, mehr, liegt ein alter Mann in seinem Sitz. Den gelben Strohhut auf dem Gesicht, scheint er zu schlafen. Auf der frisch rasierten Glatze kehren gerade die ersten rot-weißen Stoppeln zurück. Früher, so viel kann man an der käsig bis babyroten Gesichtsfarbe erkennen, muss er einen Bart getragen haben. Dort, wo er jetzt hinreist, möchte er einen ordentlichen Eindruck abgeben, korrekt, zivilisiert und vor allem anonym. Verborgen unter dem Sommerhut sucht er zwischen den Lücken des Flechtwerks den Berg, den jeder Eingeborene aus der steirischen Nationalhymne kennt und liebt. … Hoch vom Dachstein, wo der Aar noch haust. Lang nicht mehr gesehen, den Aar, den Adler. Warum nur beschleicht den stummen Alten immer wieder das Gefühl, es handele sich um eine Reise ohne Wiederkehr?
Passagiere steigen in den Bus. Routiniert wendet der alternde Handwerker den Kopf aus der Sichtlinie, zieht den Strohhut tief ins Gesicht, lässt sich weiter in den Sitz sinken, wirkt selbst wie ein lebendes Stück Transportgut.
War die Nachricht, die er Dekan Meyerhof auf dem Anrufbeantworter hinterließ, vielleicht zu lakonisch? Was sollte er denn sagen zum Tod eines Vorgesetzten, der unter den Kollegen und in der Öffentlichkeit so selbstverständlich wie voreilig als Selbstmord gehandelt wurde, obwohl er es wirklich besser wusste? Nein, er hatte der Polizei nichts von dem Mann in Schwarz erzählt, weil niemand ihm geglaubt hätte, überließ das Gerede lieber anderen. Er hatte stattdessen nur monoton wiederholt, er habe hinten im Hof gesessen, bis er Bulgakov hatte fallen hören. So war es ja auch.
Doch er kannte seinen Chef. Sechzehn Lenze lang hatten sie Schulter an Schulter gearbeitet: Bulgakov war die beste Investition des Instituts in die Zukunft gewesen, die man Ende der 60er Jahre machen konnte.
Erst zehn Jahre später, da war er auch schon alt und Hanneken noch nicht auf der Welt, hatte er den begabten Physiker kennen- und schätzen gelernt. Dekan Meyerhof hatte gut daran getan, sie beide zusammen zu stecken, denn nur in erfolgreicher Kooperation bestand eine realistische Chance, die komplexen Entwürfe des aus Osteuropa eingewanderten Erfinders auf die Füße zu stellen: Bulgakov in der Theorie, van Galten in der Praxis.
Vorbei. Hör auf mit der Nostalgie, Cord, spricht es mit ihm. Und wer ist überhaupt Cord? Ab heute heißt du Max.
Krachend schaltet der Fahrer die Gänge herunter.
Der Vergaser muss neu eingestellt werden. Auch die Bremsbacken von den Ratschenbremsen knirschen verbraucht und könnten gut ein paar frische Beläge gebrauchen. Irgendwann benötigen sie neue Busse in der Ramsau, wenn das mit dem Tourismus etwas werden soll.
«Halt den Mund, Max, dich geht das nichts mehr an. Gar nichts. Kümmere dich um deine eigenen Sachen.»
Eine alte Frau mit Kopftuch humpelt durch den Bus, hangelt sich mit beiden Armen an den Sitzen vorwärts ziehend auf ihn zu, platziert sich neben ihn, stellt ihre Einkaufstasche ungefragt zwischen seine Beine, blickt ihn an wie einen Bekannten, erwartet keine Antwort oder Reaktion seinerseits.
Bulgakov war bekannt wie ein bunter Hund. Nicht, dass er sich eitel exhibitionieren wollte, - Grund hätte er gehabt - aber genau dies schien der sicherste Weg zu sein: Je mehr alle wussten von den immer vorhandenen, doch ungenutzten Energien des Äthers, desto besser. So lautete die vollmundige Devise des Querkopfes. Das war der Plan. So hatte Bulgakov in liebreizend österreichischem Dialekt mit Akzent begonnen, Interviews zu geben, sich der Presse und anderen Forschern gegenüber zu öffnen. Cord hatte es aus dem Hintergrund heraus unterstützt. Gekonnt hielt er sich selbst dabei im Hintergrund – feige, wie er war.
Er streift den Hut vom Gesicht. Ein stöhnendes Seufzen entweicht ihm und die Bauersfrau neben ihm zieht ein Augenlid hoch, schaut ihn mit einem fragenden Gesichtsausdruck an. Er linst kurz zurück, nickt, winkt dann ab. Der Omnibus nimmt eine Kurve. Es ist gleichzeitig sonnig und kalt heute Morgen. Heiß oder kalt?
Ein murmelndes Raunen der Touristen geht durch den Bus, als das Dachsteinmassiv in das Blickfeld rückt. Majestätisch und nebelverhüllt wie eine Diva schweben weißliche Schwaden vor dem Gipfel, einer verschleierten Königin gleich, die sich erst zeigen wird, wenn es an der Zeit ist. Bisweilen treibt der Wind Nebelschwaden so dicht zueinander, dass das Bergmassiv völlig verschwindet und die kleinen Häuser mit den Bataillonen an Geranien auf den Balkons nurmehr vor einer milchig weißen Wand existieren. Und jetzt werd ich zum Berg», denkt sich das Gehirn von Cord, der sich gerade in einen Max transformiert.
Als Hausmeister und heimlicher Werkstattleiter hatte er es für besser gefunden, aus der Schusslinie herauszutreten. Warum nicht die eigene Bedeutung für das Institut so weit als möglich herunterfahren? Nur noch als exzentrischer, gutartiger Zausel wollte er sein Leben fristen. Ein Unikum, das tagaus, tagein in einem grauen Kittel über die Flure schlurfte, überall auftauchte, wo es ein Problem zu bewältigen, Rätsel zu lösen gab. Vorbei. Das ging fix.
Niemand hatte dumme Fragen gestellt, als ihn der Dekan 1970 als Hausmeister engagierte, einen vermeintlichen Ausländer, einen holländischen Schlosser mit österreichischen Vorfahren und leicht Wiener Mundart. Und dann der Bart: Jeden historisch bewanderten Einheimischen gemahnte das Ungetüm sofort an den Forstrat, den «Mozart der Wasserphysik», seinen Meister.
«Das war halt Schicksal», pflegte Cord zu sagen, wenn ihn jemand darauf ansprach. Mein Gott, Schauberger besaß einen Genius nach seinem Geschmack: Klar, eindeutig, dabei vielseitig und immer auf Mutter Natur bedacht, deren Regeln er den Tieren, Bäumen und Flüssen abschaute.
Wenn die Leute nur begriffen, dass der Mensch den Gesetzen der Natur entsprechend und ganz ohne Verbrennung Maschinen bauen konnte, wenn er denn nur wollte. Dass es einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen Explosion und Implosion, sie aber beide Bewegung bewirken. Dass kein Fluss verschmutzt sein muss. Dass es keinen Kunstdünger braucht, weil alles lebt. Und mit wie wenigen Mitteln die Menschheit sehr glücklich sein könnte, die Äcker das Doppelte herschenken würden und dennoch nicht auslaugten. Das war nun einmal die Erfahrung, die van Galten am eigenen Leib gemacht hatte.
Bei den jungen Studenten aus der Nachkriegsgeneration war es nie eindeutig klar, welche «Natur» sie meinten, wenn sie von Naturwissenschaft sprachen. Mit den Radiowellen und der Atomenergie trat die Welt in ein Zeitalter, in dem die Gesetze der Natur und des Äthers anscheinend nicht mehr viel Wert besaßen. Oder sie erschienen einfach nur überflüssig, weil Geld das wichtigste war. Geld, Geld, Geld. Es war klar, er wirkte nur als Wichtelmännchen, ein Helfer, der selbst immer wieder fliehen musste: erst vor der Langeweile, dann vor dem Krieg, schließlich vor seinen Siegern.
Vor allem Dekan Meyerhof wusste das zu würdigen. «Bei mir haben Sie eine technische Prokura», sagte er häufig, wenn er ihn sah. Was im Klartext bedeutete, dass Cord machen konnte, was er wollte.
Читать дальше