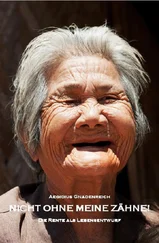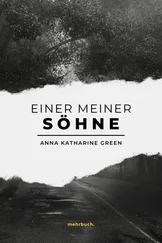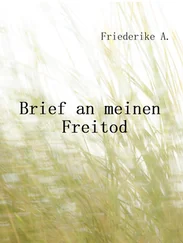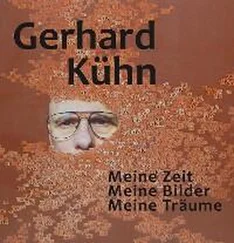Freiheit! Für die Reisebuchautorin und Biologin Carmen Rohrbach ein zentraler Begriff. „Wäre ich drüben geblieben, wäre ich irgendwann zugrunde gegangen, wäre ich krank geworden. Das hätte ich sicher nicht überlebt.“ Für sie ist es auch ein philosophischer Begriff. Selbst im Gefängnis hat sie sich nie unfrei gefühlt. „Es gibt doch das schöne Lied, die Gedanken sind frei. Umgeben von Mauern kann man trotzdem frei sein.“ Freiheit ist für sie innere Freiheit. In der DDR fühlt sie sich gefangen – „wie im Paradies, wo die Äpfel der Erkenntnis verbotene Früchte waren. Eigene Meinungen, Ideen, kritische Fragen waren unerwünscht. Nur was von ‚oben‘ verordnet wurde, galt als richtig. Wie im biblischen Paradies war für die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse gesorgt. Es gab zwar nicht alles im Überfluss, doch genug für jeden. Wer sich fügte, dessen Leben war abgesichert.“ Doch ein Kampf für die Freiheit kommt für sie nicht in Frage. „Ich hätte in der DDR nicht gegen das Regime kämpfen können. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was ich da ändern will. Ich wollte ja mein eigenes Leben verwirklichen!“
Carmen Rohrbach wird im sächsischen Bischofswerda geboren, als erstes von vier Kindern. Ihr Vater, durch schwere Granatenverletzung vom Krieg gezeichnet, glaubt ziemlich schnell an die DDR und den „besseren Weg“. Als Lehrer ist er in der SED. Für ihre Schulkameraden ist er ein „Roter“, ein überzeugter Kommunist. Für Carmen ist er die wichtigste Person in ihrem Leben. „Kein Kommunist, eher ein Idealist, der dachte, dieses Regime wird für die Menschen Gutes tun.“ Die Mutter eher unpolitisch, versucht einfach nur, die Familie durchzubringen. Die jüngste Kindheit erlebt sie in Bautzen, wo vor allem politische Häftlinge im Stasi-Gefängnis und berüchtigten „Gelben Elend“ einsitzen. Carmen nimmt das noch nicht wahr. Dann zieht es die Familie nach Sachsen-Anhalt, nach Freyburg an die Unstrut. Dort wird auch Wein angebaut. Schon damals geht sie gerne auf Entdeckertour, streift durch die Wälder, ist am liebsten allein in der Natur. Und, klar ist sie bei den Pionieren. Erhofft sich dort spannende Abenteuer. Ist dann enttäuscht über die lästigen Pflichten. Das blaue Halstuch, die weiße Bluse, die immer frisch gebügelt sein muss. Wer vergisst, seine „Tracht“ anzuziehen, bekommt Tadel und Strafpunkte.
Als sie irgendwann zufällig einen Film von Heinz Sielmann über die Tierwelt auf den Galapagos-Inseln sieht, reift in ihr der Entschluss, Biologie zu studieren. Das Studium beginnt sie in Greifswald. Dresden, Berlin oder Leipzig kommen für sie nicht in Frage. Sie reizt die Nähe zum Meer, zur Ostsee. Und Biologie will sie studieren, weil sie auf Forschungstouren in ferne Länder hofft. Wenn schon nicht nach Afrika oder Australien, dann wenigstens in die Sowjetunion, nach Kuba oder in die Mongolei. „Sibirien lockte mich. Die waldreiche Taiga, in der kaum Menschen, dafür aber Tiger, Bär und Zobel beheimatet sind.“
Erste Zweifel an der DDR kommen ihr im Studium. In Greifswald schließt sie sich einer Studentengruppe an. Deren Protest ist aber noch äußerst leise. Sie treffen sich, singen zusammen patriotische Studentenlieder. Die Studentenunruhen der 68er im Westen nehmen sie kaum wahr. „Das war nur ein konturloses Rauschen fern unseres Lebens.“ Und Ost-Berlin ist weit weg. Nach Greifswald geht es an die „rote Uni“ nach Leipzig. Das „freie Studentenleben“, wie sie es von Greifswald kannte, ist hier jäh zu Ende. In Leipzig trifft sie auf Studenten, die sich für das „sozialistische Kollektiv“ einsetzen. Doch mit dem Herzen ist niemand richtig dabei. Die sozialistische Fahne wird nur hochgehalten, weil es Vorteile bringt. „Mein Glaube an die DDR wurde gründlicher zerstört als in Greifswald.“ Als sie sich für eine Stelle als Forschungsstudentin in Kuba bewirbt, landet sie endgültig in der Realität. Ihr Antrag wird abgelehnt, weil sie Verwandte im Westen hat. „Der Himalaya, die Anden, Feuerland, Kamtschatka waren in unerreichbare Ferne gerückt... Ich war verurteilt. Das Urteil hieß lebenslänglich. Mit dem Urteil, immer in der DDR bleiben zu müssen, nie Dschungel, Wüste, Gebirge, nie andere Länder und Völker kennenzulernen, erlosch mein Lebenswille. Wozu leben? Umsonst hatte ich mich all die Jahre angepasst, Regeln und Verordnungen befolgt.“
Nach dem Scheitern ihrer dramatischen Flucht über die Ostsee beginnt ihre „Reise“ durch die DDR-Gefängnisse: Rostock, Halle und schließlich Hoheneck. „Es war wie ein Abstieg in den Hades, in eine verborgene, mystische Unterwelt. Bisher hatte ich im Licht gelebt, mit einer geschönten Fassade vor Augen, nun sah ich die schamhaft versteckten Hinterhöfe, tauchte ein in Kloake und Schmutz.“ Sie erlebt Erniedrigungen, Entbehrungen und Hunger. Am schlimmsten ist immer wieder die Zeit in Einzelhaft – im Loch. Einem höhlenartigen Verlies aus kaltem Stein, in dem es nicht einmal eine Matratze gibt, nur eine dünne Decke auf einem nackten Betonsockel. Nur jeden dritten Tag gibt es etwas zu essen, mit- tags eine dünne Suppe. „In dieser Zeit beginnt die innere Ablösung von dem Land, in dem ich geboren bin. Die Empfindung, einmal in der DDR zu Hause gewesen zu sein, kommt mir abhanden, und ich verliere meine Heimat für immer.“
Während Carmens Haftzeit sind in Hoheneck mehr als 1.500 Frauen eingepfercht. Es ist das größte Frauengefängnis der DDR, berüchtigt für seine Dunkel- und Wasserzellen. Seit 1863 wird das ehemalige Schloss als Gefängnis genutzt. Ursprünglich ist das modrige Gemäuer mal für 230 Gefangene ausgelegt. „Es herrschen katastrophale Zustände. Dass ein Gefängnis wie dieses in der DDR existiert, habe ich nicht für möglich gehalten.“ Die Republikflüchtigen sind in der Minderheit. Meist zur viert teilen sie sich mit mindestens 20 Kriminellen den Verwahrraum. „Verwahrraum, eine treffende Bezeichnung für eine Zelle mit acht Dreietagenbetten für 24 Frauen, ohne Möglichkeit, sich auch nur einen kleinen persönlichen Bereich zu schaffen. Am schlimmsten war es, dass sie uns Republikflüchtige brechen wollten. In den zwei Jahren und acht Monaten Haftzeit habe ich die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Die- se Lebensphase war irgendwie auch wertvoll. Aber für meine Eltern war es hart.“ Ihre Tante im Westen leitet schließlich den Freikauf Carmens in die Wege. DDR-Unterhändler und Rechtsanwalt Wolfgang Vogel erwirkt die Transaktion. Von 1964 bis 1989 kaufte die Bundesrepublik fast 34.000 politische Häftlinge frei. Für die DDR ein lukratives Devisengeschäft. Als Carmen schließlich im Westen ankommt, ist es erst „gar kein beglücken- des Gefühl. Es dauerte eine Weile, bis ich begriffen hatte, dass ich wieder frei bin.“
Weil sie wieder wissenschaftlich arbeiten will, geht sie nach Bayern. In Seewiesen promoviert sie am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung. Das erste Mal ist sie 1986 wieder in der DDR. „Vorher wurden alle meine Einreiseanträge abgelehnt. Nach meiner Ausweisung in den Westen war ich im Osten eine unerwünschte Person.“ Der Mauerfall im November 1989 ist somit für sie auch eine Art Befreiung. Am 9. November ist sie in München, kommt gerade von einer Pilgerreise zurück, vom Jakobsweg. Damals lebt sie in einer Wohngemeinschaft am Rotkreuzplatz. Ihre Mitbewohner bereiten ihr einen feierlichen Empfang, das Treppen- haus ist geschmückt, an der Tür hängt ein großes Plakat. „Endlich frei!“ ist da zu lesen. Carmen weiß damit gar nichts anzufangen. „Ich dachte nur, die meinen vielleicht gar nicht mich, weil es in dem Moment gar nicht auf mich zutraf. Ich kam ja vom Jakobsweg. War noch wie eine Pilgerin gekleidet.“ Die Montagsdemonstrationen in Leipzig hatte sie noch vor ihrer Abreise mitbekommen. Aber die berühmte Pressekonferenz mit Günter Schabowski, die Grenzöffnung, die tanzenden Menschen auf der Berliner Mauer, all das sieht sie erst später im Fernsehen.
Читать дальше