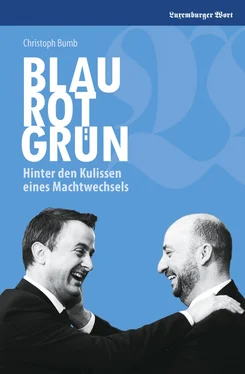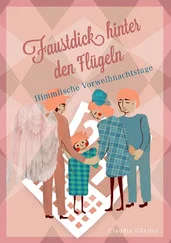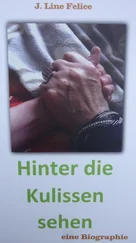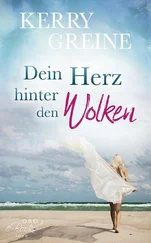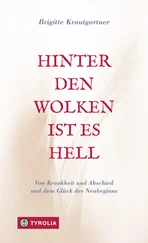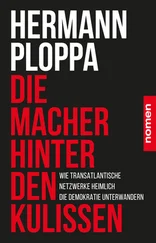Bis heute ist nicht ganz klar, wie es zu der fast schon surrealen Kommunikation der Regierung in Sachen Budget 2013 kommen konnte. In jedem Fall war es der vorerst letzte Ausdruck einer nicht mehr zu kohärentem Handeln fähigen Koalition. „Dass wir uns uneinig gewesen wären, wäre noch untertrieben formuliert“, sagt einer, der an den koalitionsinternen Diskussionen beteiligt war. Infolgedessen wurden die Streitigkeiten immer mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen. Die CSV beschuldigte den Koalitionspartner als „Bremser“ dringend notwendiger Reformen. Dagegen stellte die LSAP die CSV und insbesondere Finanzminister Frieden als eiskalten, unsozialen Haushaltssanierer dar. Die Maßnahmen der Regierung zur Bewältigung des in den Krisenjahren ausufernden Haushaltsdefizits stellten schließlich keine der beiden Seiten so richtig zufrieden. Was früher vielleicht noch als brillanter Kompromiss des Premiers gefeiert worden wäre, erschien angesichts des Reformdrucks in Zeiten der Finanzkrise immer mehr als mutloses politisches Handeln.
Unter der Oberfläche der politischen Inhalte nahmen allerdings auch die persönlichen Animositäten zu. Hinter den Kulissen gingen die Koalitionspartner immer öfter auf Konfrontationskurs. Auch innerhalb der CSV sollte der Streit um die Haushaltspolitik nicht ohne Folgen bleiben. Die Kontroverse um den richtigen Regierungskurs offenbarte nicht zuletzt einen tiefen politischen und bald auch zunehmend persönlichen Dissens zwischen Premierminister Juncker und Finanzminister Frieden. Wie mehrere Weggefährten berichten, ging Juncker seinen eigentlich auserkorenen Nachfolger mehrmals vor versammelter Regierungsmannschaft an. Aus dieser Zeit stammt denn auch der mittlerweile berühmte, weil von vielen damals Beteiligten gestreute Satz, mit dem der Premier seinen Finanzminister schließlich offen vorführte: „Finanzpolitik besteet aus zwee Wierder: Finanzen a Politik. Vu Finanze mengs de eppes ze verstoen. Vu Politik, soen ech der, wäerts de ni eppes verstoen.“ Schon innerhalb der CSV war man sich also offensichtlich nicht einig über die einzuschlagende politische Richtung. Juncker gegen Frieden, sozialer gegen liberaler Flügel, Süden gegen Zentrum: Die Episode des Budgets 2013 war wie ein Sinnbild für die andauernden politischen Gegensätze und Widersprüche in der Volkspartei.
Jean-Claude Juncker räumt im Rückblick ein, dass die unterschiedlichen Auffassungen einer angemessenen politischen Antwort auf die Finanzkrise sowohl die Koalition als auch seine eigene Partei auf die Probe stellten. So hätte sich die LSAP mit mutigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung schwergetan. Immer wieder habe er einigen Parteifreunden erklären müssen, warum er als Regierungschef den sozialistischen „Vetos“ nachgab. Andererseits entsprachen diese politischen und sozialen Empfindlichkeiten des Koalitionspartners auch weitgehend Junckers persönlichen Überzeugungen. „In der CSV gab es bei einer nicht unwesentlichen Minderheit die Tendenz, einen radikalen Sparkurs zu fahren, der mit mir nicht zu machen war“, so der damalige Premier aus heutiger Sicht.
Die Koalition aus CSV und LSAP, die in der jüngeren politischen Geschichte des Großherzogtums der Regelfall war, erschien jetzt immer mehr wie ein einziges Missverständnis. So flirtete der wirtschaftsliberale Flügel der CSV mitten in der Legislaturperiode offen mit der DP, mit der man sich eine bessere Umsetzung der eigenen finanz- und wirtschaftspolitischen Ziele erhoffte. Wäre die Amtszeit der Regierung bis 2014 regulär verlaufen, so wäre eine CSV-DP-Koalition unter normalen Umständen nach den Wahlen wohl die logische Folge gewesen. Doch die weitere Legislaturperiode verlief alles andere als regulär. Das medial befeuerte Schauspiel um den Haushalt 2013 war nämlich nur die Spitze des Eisbergs.
***
Parallel zur politischen Entwicklung konnte man eine Wandlung des Führungsstils von Jean-Claude Juncker erkennen. Als Chef der Eurogruppe war er als einer der Hauptakteure an der Rettungspolitik innerhalb der Eurozone beteiligt. In der Öffentlichkeit wurde Juncker auch vor allem als Europapolitiker wahrgenommen. Zugleich war er in der Heimat immer öfter abwesend. Er zog zwar weiter im Hintergrund die Strippen, ließ den Dingen ansonsten aber immer mehr ihren Lauf. Wichtige Sitzungen wurden von Junckers Staatsministerium nicht mehr vorbereitet. Der Premier selbst versäumte es aber auch, strategische Personalentscheidungen zu treffen oder innenpolitische Dossiers in seiner Abwesenheit an Vertraute zu delegieren. Alles hing an Juncker und von Juncker ab. In guten Zeiten hinterfragten dieses System nur die wenigsten. In Krisenzeiten wurden die Zweifel an der politischen Führung im Land aber immer offensichtlicher.
In der eigenen Partei hatte der „Chef“ diesbezüglich zwar kein Unheil und schon gar keine ernsthafte Konkurrenz zu befürchten. Doch auch in der CSV machte sich langsam, aber sicher Unmut breit, der allerdings nur hinter vorgehaltener Hand geäußert wurde. Genau in diese Zeit fallen jedenfalls diverse Episoden, bei denen Juncker seine Parteifreunde in internen Sitzungen geradezu zusammenfaltete. „Was wärt ihr denn schon ohne mich?“ ist dabei nur eine der ihm in Fraktionssitzungen der Christsozialen zugeschriebenen Aussagen. Mit zunehmender Dauer seiner Amtszeit entwickelte Juncker nicht nur einen herablassenden Umgang mit seinen politischen Mitstreitern, sondern auch ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. So sympathisch, kumpelhaft und mitunter warmherzig Juncker als Privatperson beschrieben wird, so gnadenlos konnte er im Umgang mit politischen „Freunden“ sein. „Einige haben es drauf und sind würdig, mit ihm auf Augenhöhe zu sprechen, alle anderen sind unfähig“, beschreibt ein langjähriger Weggefährte aus der Partei Junckers Selbstverständnis und den entsprechenden Wandel des Führungsstils des seit 1995 amtierenden Premiers.
Auch der Alkohol spielte eine Rolle. Was in der politischen Klasse bis heute als offenes Geheimnis behandelt wird, ist für viele von Junckers Weggefährten mit ein Grund, der vor allem im Zuge seines gescheiterten Abschieds nach Brüssel zur stetigen Verschlechterung der Arbeitsatmosphäre beigetragen hat. Nicht selten wurden Klausursitzungen abgebrochen oder vertagt, weil der Premier „nicht mehr auf der Höhe“ war, wie es ein langjähriges Regierungsmitglied im Rückblick formuliert. Im Ministerrat sei es demnach zunehmend auf Junckers Launen angekommen, ob er überhaupt zu substanziellen politischen Gesprächen fähig war oder sich eher in fast schon surreal anmutenden, persönlich-biografisch geprägten Monologen erging. Lange habe sich sein Lebensstil zwar nicht negativ auf seine politische Arbeit ausgewirkt. Laut Aussagen seiner Weggefährten entwickelte sich Junckers schwerlich verborgene Neigung zu dauerhaftem Alkoholkonsum, die sich etwa in morgendlichen Apéros oder stundenlangen feucht-fröhlichen Arbeitsessen äußerte, in Kombination mit seinem ohnehin schon launigen Regierungsstil für sein unmittelbares Arbeitsumfeld jedoch zunehmend zum Problem. Dass der Regierungschef auch deswegen immer weniger in der Lage war, die Richtung der Politik vorzugeben oder Streitigkeiten innerhalb seiner Koalition zu schlichten, steigerte bei vielen Vertrauten nur die Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation.
Der Juncker in diesen Jahren zudem zugesprochene geringschätzige bis offen verachtungsvolle Umgang mit Parteifreunden und Koalitionspartnern hinterließ viele offene Wunden, die bei so manchem Beteiligten inner- und außerhalb der Partei den Wunsch nach politischer Rache reifen ließ. Und dennoch: In der eigenen Partei funktionierte das „System Juncker“ bis zum Schluss. Fraktion und Parteiführung wurden oft vor vollendete Tatsachen gestellt. Die wahren Entscheidungen wurden so nicht in den regulären Gremien der Partei, sondern im Vorfeld zwischen wenigen Personen getroffen und dann von den Parteiorganen nur noch abgesegnet. Ähnlich funktionierte das System in der Regierung. Der Ministerrat war nur selten der Ort für eine offene Aussprache; diese hatte der Staatsminister meist schon im Vorfeld mit auserwählten Personen gesucht. So hatte Juncker nach und nach ein machtpolitisches Kommunikationsnetz geschaffen, das allein auf ihn zugeschnitten war. Als er aber wegen seiner zunehmenden Abwesenheit zu Hause die Zügel der Macht aus der Hand gab, wendete sich allmählich das Blatt. Alle von ihm im kleinen Kreis gekränkten und mitunter auch im erweiterten Kreis offen bloßgestellten Weggefährten warteten eigentlich nur auf die richtige Gelegenheit, sich zu rächen.
Читать дальше