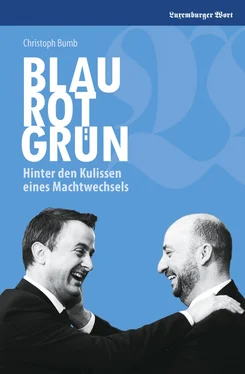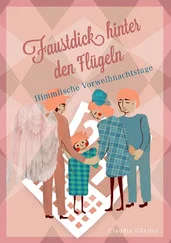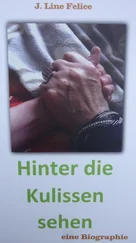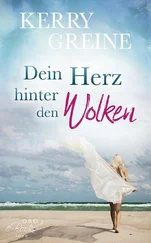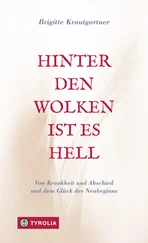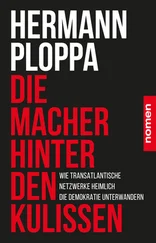Diese alternative Mehrheit war rein rechnerisch an sich auch nichts Neues. Es gab sie schon lange. Seit es die Grünen als parlamentarisch vertretene Partei überhaupt gibt, bestand prinzipiell die Möglichkeit einer Dreierkoalition ohne die CSV. Auch schon davor hätten DP und LSAP ihre arithmetische Übermacht das eine oder andere Mal nutzen können, denn die CSV verfügte allein nie über die absolute Mehrheit. Der Aufstieg der Grünen veränderte dann zwar die Parteienlandschaft, änderte zunächst aber nichts an der Vormachtstellung der CSV. Doch die Mehrheit und damit die Möglichkeit einer alternativen Koalition war immer gegeben: Nach den Wahlen von 1994 verfügten LSAP, DP und Déi Gréng zusammen über 34 von 60 Sitzen, nach 1999 über 33 und ab 2004 über 31 Mandate. Nur 2009, als die CSV ihr historisch bestes Resultat von 26 Sitzen erzielte, die ADR vier und Déi Lénk einen Sitz errangen, gab es keine arithmetische Mehrheit mehr für Blau-Rot-Grün. Von der rechnerisch möglichen zur politisch nutzbaren Mehrheit sollte es aber ohnehin noch ein langer Weg sein.
***
Schon zu Beginn des neuen Jahrtausends führte die politische und wirtschaftliche Großwetterlage dazu, dass die etablierten Parteien zusammenrückten. In der Folge entstand ein pragmatisches Parteienkartell, das unabhängig von der jeweils regierenden Koalition die großen politischen Fragen im Konsens beantwortete. So lösten alle großen Parteien gemeinsam 2008 die „institutionelle Krise“, die aus der Weigerung von Großherzog Henri, das Euthanasiegesetz zu unterschreiben, entstanden war. Die Kompetenzen des Staatsoberhaupts wurden per Verfassungsreform, also im überparteilichen Konsens beschnitten. Fortan sollte der Großherzog die Gesetze nicht mehr gutheißen, sondern nur noch verkünden dürfen. Unabhängig von ihrer jeweiligen Meinung zur Reform der Gesetzgebung über die Sterbehilfe waren sich alle Parteien einig, dass dem Staatschef eine aktive Einmischung in parlamentarische Angelegenheiten nicht zustand.
Auch die globale Finanzkrise führte ab 2008 zur reflexartigen Wiederbelebung des Luxemburger Konsensmodells in Form einer Neuauflage der großen Koalition aus CSV und LSAP ab 2009, mit zunächst eher wohlwollender Begleitung durch die blau-grüne Opposition. Für Juncker und den sozialen Flügel in der CSV stand außer Frage, dass man die Zusammenarbeit mit den Sozialisten in Krisenzeiten fortführen müsse. Andererseits stieß man damit zumindest die Grünen vor den Kopf, die sich nach den Nationalwahlen von 2009 insgeheim zumindest Hoffnungen auf Koalitionsgespräche gemacht hatten. Fünf Jahre zuvor hatte Juncker der grünen Parteiführung nämlich zu verstehen gegeben, dass Schwarz-Grün bei entsprechend stabilen Mehrheitsverhältnissen für ihn zumindest eine Option sei. 2004 verfügten CSV und Déi Gréng zusammen allerdings nur über 31 Sitze. Doch auch 2009 mit der potenziellen komfortableren schwarz-grünen Mehrheit von 33 Mandaten entschied sich Juncker für die sichere Variante einer Fortsetzung der Koalition mit der LSAP.
Die Bewältigung der Krise offenbarte aber auch schnell Risse in der Fassade der in Krisenzeiten eigentlich traditionellen Überparteilichkeit. Das schleichende Scheitern des sozialen Dialogs à la Tripartite und der bald öffentlich ausgetragene Koalitionsstreit zwischen CSV und LSAP über die Sparmaßnahmen der Regierung sollten bei allen Beteiligten tiefe Spuren hinterlassen. Hinzu kam die Tatsache, dass Jean-Claude Juncker in seinem Streben nach dem Posten des ersten ständigen EU-Ratspräsidenten scheiterte. Nicht er, sondern der Belgier Herman Van Rompuy wurde im November 2009 von den Staats- und Regierungschefs für dieses Amt nominiert. Im Gegensatz zu 2004, als Juncker der Posten des Kommissionspräsidenten angeboten wurde, er aber nicht zugriff, war es 2009 ziemlich genau das Gegenteil. Juncker wollte unbedingt Ratspräsident werden, konnte sich in den Reihen seiner europäischen Amtskollegen aber nicht durchsetzen. Nicht zuletzt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy verweigerten dem Luxemburger Premier die Unterstützung – ein Affront, der sich für den stolzen Europapolitiker Juncker laut seinen Mitarbeitern zu einem nie überwundenen Trauma entwickeln sollte.
Zur persönlichen Enttäuschung des Premiers, der aus seinen Wechselabsichten nach Brüssel keinen Hehl gemacht hatte, gesellte sich bald schon die zunehmende Ernüchterung einiger Parteikollegen, die sich durch Junckers Abtreten von der nationalen Bühne eigene Karrierechancen erhofft hatten. Insbesondere die als „Kronprinzen“ gehandelten Luc Frieden und Claude Wiseler mussten sich demnach weiter in Geduld üben. Vor allem Frieden galt im Vorfeld der Wahlen von 2009 als Junckers natürlicher Nachfolger. Im kleinen Kreis verhielt sich der bis dahin erfolgsverwöhnte christlich-soziale Überflieger auch schon wie der kommende Regierungschef. Juncker selbst hatte im Wahlkampf im Gegensatz zu 2004 einen Wechsel nach Brüssel auch nicht explizit ausgeschlossen. Dass Juncker schließlich doch Staatsminister blieb, kam einer öffentlichen Demütigung von Luc Frieden gleich, die das weitere Verhältnis der beiden Spitzenpolitiker nachhaltig prägen sollte.
Das Jahr 2009 gilt bei vielen Akteuren und Beobachtern des politischen Betriebs demnach als Schlüsseljahr. Die Finanzkrise und die ab 2008 einsetzende Dauerdebatte um die Krisenfolgen für Luxemburg waren der Ausgangspunkt für die bald folgende politische Krise. Die in der Vergangenheit immer kollegial, politisch und persönlich auf Augenhöhe geführte Koalition aus Christsozialen und Sozialisten verlor sich zunehmend in Streitereien und im parteipolitischen Klein-Klein. Sowohl bei der LSAP als auch bei der CSV reifte in dieser Zeit die Überzeugung, dass die Zusammenarbeit in der großen Koalition trotz der überaus komfortablen parlamentarischen Mehrheit von 39 von 60 Sitzen nicht mehr alternativlos war. Doch die Auseinandersetzung um den Umgang Luxemburgs mit den Konsequenzen der globalen Krise sollte nur der Anfang einer Folge von Affären und Kontroversen sein, die die große Koalition schließlich auf eine harte Probe stellen würde.
Durch die immer lauter geführten regierungsinternen Diskussionen um die Ausrichtung der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik stand die Neuauflage der CSV-LSAP-Regierung ab 2009 eigentlich von Beginn an unter einem schlechten Stern. Schon die Koalitionsverhandlungen gestalteten sich laut mehreren Beteiligten ungewöhnlich schwierig. „Es gab keine Dynamik, kein gemeinsames Projekt“, erinnert sich Alex Bodry, damals Parteichef der LSAP. Fünf Jahre zuvor hatte es noch so etwas wie eine politische Aufbruchstimmung gegeben. Die Anker der großen Koalition – Jean-Claude Juncker, Jean Asselborn, François Biltgen, Mars Di Bartolomeo oder Lucien Lux – vertrauten sich, ja sie waren in vielen Fällen persönlich befreundet und lagen auch inhaltlich in den zentralen Fragen auf einer Linie. Die Zusammenarbeit zwischen Christsozialen und Sozialisten bezeichnete Juncker stets als „seine“ Koalition.
Während man sich jedoch 2004 noch schnell einig wurde und im Detail ein gemeinsames Programm ausarbeitete, gerieten die Koalitionsgespräche im Sommer 2009 schnell ins Stocken. Angesichts ihrer historischen Stärke wollten einige CSV-Mitglieder dem Koalitionspartner auf einmal ihre Sicht der Dinge diktieren. Selbst Minister spielte immer wieder allein schon die arithmetische Stärke der CSV aus. „26 zu 13“ – dieser Hinweis auf das parlamentarische Kräfteverhältnis zwischen Christsozialen und Sozialisten entwickelte sich in den folgenden Jahren zum geflügelten Wort. Immer wieder rechneten CSV-Politiker ihrem Koalitionspartner bei strittigen Fragen als unverhohlene Warnung die Sitzverhältnisse vor. Als die LSAP sich durch diese immer öfter aufkommende CSV-Attitüde nicht einschüchtern ließ, kam es aber weder zum Bruch noch zum Kompromiss, sondern man sparte die unangenehmen Dossiers einfach aus. Gerade in der Finanz- und Haushaltspolitik ging das Kabinett Juncker-Asselborn II demnach ohne wirkliches Programm in die von Beginn an durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise überschattete neue Legislaturperiode. Der mangelnde Wille zum programmatischen Kompromiss schlug sich dann in den folgenden Monaten auch in der zwischenmenschlichen Stimmung am Kabinettstisch nieder. Von Freundschaft war zwischen Schwarzen und Roten bald keine Spur mehr.
Читать дальше