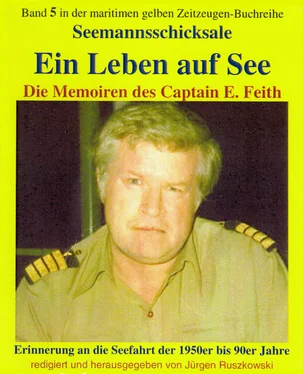Wurde mit „eigenem Geschirr“, also den Ladebäumen des Schiffes gelöscht oder geladen, mussten zwei Mann an jeder Seite an den Geien (eine Art Flaschenzüge) stehen und den Ladebaum in die Mitte der Luke schwingen. Der Mann an der Winde fierte (senkte) das Stahlseil wie bei einem Kran mit dem Haken in den Laderaum. War die Last dort angeschlagen, wurde sie nach oben gehievt, bis sie frei über der Luke hing. Nun wurde der Ladebaum durch die Geien per Hand durch zwei Leute nach außenbords geschwenkt bzw. gezogen, wobei die Gei innenbords langsam gefiert (in diesem Fall vorsichtig nachgegeben) werden musste. Schwebte die Last außenbords, wurde sie mit der Winde gefiert und von den Hafenarbeitern an Land abgeschlagen. Der Ladebaum wurde dann ohne Last mittels der Geien wieder innenbords geschwenkt. Der Vorgang wiederholte sich solange, bis das Schiff gelöscht war. Für die Leute an den Geien war es harte Knochenarbeit, und meistens mussten wir Junggrade die Geien bedienen. Meistens stellte das Schiff beim Lade- und Löschbetrieb die Winden- und Geienbedienungen selber. Von den Leuten an den Motorwinden forderte es höchste Konzentration, die bis zu 1 ½ Tonnen schweren Lasten sicher an Land oder Schiff zu bringen.
Passte der Winchmann einmal nicht auf und die Last fiel herunter, konnte es, vom hohen Sachschaden einmal abgesehen, zu tragischen Folgen kommen und auch Menschenleben gefährden. Besonders im Winter bei eisiger Kälte hatte man nach acht oder zwölf Stunden Arbeit an den Winschen kein Gefühl mehr in den Fingern. Darum löste man den Windenmann alle zwei Stunden für zehn Minuten ab, wobei meistens der Alte oder der Steuermann solange einsprangen. Auch wir Schiffsjungen mussten, wenn wir an den Geien standen, höllisch aufpassen, dass der Ladebaum mit der Last nicht außer Kontrolle geriet und gegen den Mast schwang, denn daraus konnten sich böse Konsequenzen ergeben, von der körperlichen Anstrengung, die das Bedienen der Geien erforderte, ganz zu schweigen. Die meisten von uns hatten keine richtige Winterkleidung. Wir trugen fast alle Gummistiefel, die wir mit Papier und Lumpen ausgestopft hatten und froren furchtbar. Ging ich mit dem Alten im Winter bei Nebel Seewache, stand er am Ruder und ich sechs Stunden als Ausguck vorne auf der Back. Ich habe später in meinem Leben nie wieder so gefroren, wie in der Zeit als Moses. Erst später als Jungmann konnte ich mir einige gebrauchte Wintersachen kaufen.
Meine damalige Heuer betrug, alles inklusive, 60 Mark im Monat. Eine gute Hose kostete über 50 Mark. So kann man sich vorstellen, wie ich herumlief. Da der Eigner wegen meines abgerissenen Aussehens um seinen Ruf fürchtete, schenkte er mir ein paar abgetragene Kleidungsstücke und Schuhe. Der Alte behielt meine Heuer für mich ein und sorgte dafür, dass ich mir davon Arbeitskleidung (!) und andere wichtige Utensilien kaufte. Ich bekam dann mal 20 Mark für den „Putzbüttel“ (Friseur), für Zahnpasta, Socken etc. und musste ihm die gekauften Sachen vorzeigen. Manchmal, wenn er gute Laune hatte, gab er mir am Monatsende großzügig 10 Mark Taschengeld, die ich nach eigenem Belieben durchbringen durfte.
Einen Tag vor Heiligabend, wir lagen in Hamburg, musterten „Hundepint“ als Leichtmatrose und Günther als Matrose ab. Sie hatten ihre Zeit voll und wollten nach der Weihnachtszeit auf Große Fahrt gehen. Mir tat es leid, dass sie gingen, denn beide hatten sich als großartige Kameraden erwiesen, und vor Günther hatten selbst der Alte und der Steuermann einen gewissen Respekt, so dass sie sich ihm gegenüber nicht alles erlaubten. Ich habe beide nie wiedergesehen. Günther soll später das große Kapitänspatent gemacht haben und Lotse geworden sein. Von Manfred alias „Hundepint“ hieß es, er sei auf der Reeperbahn gestrandet. Da das Schiff über die Feiertage in Hamburg liegen bleiben sollte, gingen der Alte und der Steuermann die Zeit über zu ihren Familien nach Hause. Daisy sollte die Zeit bei unserem Eigner verbringen. Nur wir beiden Schiffsjungen mussten an Bord verbleiben. Der Eigner gab jedem von uns einen mickrigen bunten Teller und 10 Mark mit der Mahnung, ja gut auf das Schiff aufzupassen. Es war schon ein eigenartiges Gefühl, als wir zwei Mosese am Heiligen Abend mutterseelenallein vorne in unserem Logis unter der Back bei Petroleumlicht saßen. Wir dachten an die vielen „anständigen Leute“ an Land, die jetzt gewiss unter dem Christbaum ihre Geschenke auspacken und anschließend ihren Weihnachtsbraten verzehren würden. Auch hatten wir furchtbaren Kohldampf, denn außer Kommissbrot, Heizer-Jam, Margarine, etwas Käse und Dauerwurst, lag in der Kombüse nur noch ein vorgefertigter winziger „falscher Hase“, der für drei Mahlzeiten reichen musste.
Bis auf das Ruderhaus, den Maschinenraum und die Kombüse war achtern alles abgeschlossen, auch die Speisekammer an der Steuerbordseite. Peter und ich erinnerten uns an die etwa zwanzig schönen kleinen geräucherten, jeweils ca. 500 g schweren Speckseiten, die an der Decke der Speisekammer an Haken hingen und uns einmal im Monat zu Plum un Klüten lecker mundeten. Wir erinnerten uns aber auch an das Bullauge der Speisekammer, welches immer offen stand, aber durch zwei senkrechte Metallstäbe gesichert war. Da überkam uns trübselig Sinnenden am Heiligen Abend ein ganz unheiliger Gedanke: Es müsse doch möglich sein, von außen mit einer Stange oder ähnlichem Werkzeug die Speckseiten vom Haken zu liften und durch die Lücke zwischen die Gitterstäbe hindurch nach außen zu ziehen. Die Speckseiten hatten eine Dicke von 5 bis 6 cm und hingen mit ihren Bindfadenösen an den Haken, während die Lücke zwischen den Gitterstäben 10 cm betrug. Unser Hunger war inzwischen so groß geworden, dass wir unverzüglich zur Tat schritten.
Zunächst nahmen wir einen Besenstiel, schraubten einen Kleiderbügelhaken mit seinem Gewinde auf den Stiel und hatten so eine Angel. Der zweite Schritt war etwas schwieriger, da es stockdunkle Nacht war und unser Schiff außer den zwei vorgeschriebenen mit Petroleum betriebenen Hafenlampen am Steven und am Heck völlig im Dunkeln lag. Nur an der Gangway hing noch eine Petroleumfunzel, die man aber vergessen konnte. Wir hängten bei dieser Dunkelheit unsere große Malerstellage, die wir von Deck holen mussten, außenbords direkt unter das Bullauge der Speisekammer. Ausgerüstet mit unserer provisorischen Angel und unserer Brückentaschenlampe machten wir uns ans Werk. Es ging einfacher als wir dachten. Während ich auf der Stellage mit der Taschenlampe leuchtete, angelte Peter neben mir vier ansehnliche Speckstücke und eine große Rauchwurst vom Haken. Gott sei Dank, feierte auch die Wasserschutzpolizei, die sonst ihre Streife im Hafen fuhr, wahrscheinlich irgendwo das Weihnachtsfest. Wir zündeten unseren Kohleherd in der Kombüse an und nie wieder hat mir ein „Weihnachtsbraten“ besser geschmeckt, als an jenem Heiligen Abend des Jahres 1952. Unser Mundraub fiel nie auf, und wenn, so wurde niemals darüber gesprochen, denn auch der Eigner bediente sich manchmal im Hafen aus der Speisekammer.
Nach den Feiertagen kamen der Alte und der Steuermann wieder an Bord zurück, aber da wir erst im neuen Jahr eine Ladung bekommen sollten, verschwanden sie meist schon mittags. Der Steuermann sah ziemlich zahm und abgekämpft aus, was selbst dem Alten auffiel, denn er sagte einmal: „Mensch, seine Alte muss ihn ja jeden Abend ganz schön rannehmen. Wenn wir hier auslaufen, kann die nachher bestimmt 14 Tage lang kein klares Wasser mehr pissen.“
Auch der Eigner ließ sich ein paar mal an Bord sehen. Er brachte immer seinen Anhang oder einige Gäste mit, und Peter musste dann einen „guten Kaffee“ kochen. Einmal kamen auch seine Tochter und deren Freundin, die uns wie zwei exotische Tiere betrachteten. Auch Peter und ich bestaunten die beiden wie Lebewesen aus einer uns unbekannten fremden Welt. Sie waren beide sehr elegant gekleidet und hatten jenen Ausdruck in den Augen, mit denen früher vielleicht die adligen Feudalherren ihre Stallburschen oder Leibeigenen betrachtet haben mögen. Wir beide sahen aber auch sehr kurios aus. Ich trug eine total abgerissene schwarze speckige Hose, deren Schlitz mit einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde, dazu einen blauen ausgefransten, von Motten zerfressenen Pullover mit Rollkragen, den Günther an Bord gelassen hatte, von meinen Schuhen, die an den Hacken mit Segelgarn repariert und mit Farbe beschmiert waren, gar nicht zu reden. Wir trugen unsere Schuhe an Deck bei der Arbeit, auch beim Malen und gingen damit ebenso beim Landgang in die Stadt. Aber was konnte man sich als Moses schon für 50 Mark Monatsheuer netto kaufen? Unser Anblick muss selbst den Eigner geschmerzt haben, denn am nächsten Tag kaufte er uns jedem eine Latzhose und vernünftiges Schuhwerk. Seine Tochter war eine große schlanke dunkelhaarige 19jährige Dame, die Freundin das blonde Gegenstück. Beide sprachen gewählt mit unterkühltem Ton und waren für uns unerreichbar.
Читать дальше