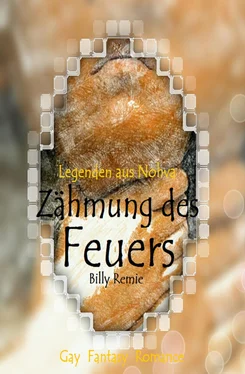1 ...6 7 8 10 11 12 ...43 Die Worte seines Vaters erleichterten Cohen keineswegs. Er fühlte sich immer noch wie ein Feigling. Vermutlich, weil Cocoun ihn zwei Wochen lang als solchen beschimpft hatte.
»Für mich findest du immer Ausreden«, murmelte Cohen mit starren Blick zu Boden, »für deinen jüngsten Sohn hast du keine gefunden.«
Noch bevor er es ausgesprochen hatte, spürte Cohen des Königs strengen Blick auf sich.
Er drehte sich um und verbarg damit vor seinem Vater den Kummer, der in seinen Augen lag. Hinter ihm befand sich ein Buntglasfenster, aus dem er hinauszusehen versuchte. Doch die schönen Gärten der Burg wurden durch das rote Karo, aus dem er hinausblickte, nur zu etwas, das ihn wieder an den Krieg erinnerte.
Warum färbte sich alles rot wie Blut, egal, wohin er ging?
Lag es an ihm, oder an der Zeit, in der er lebte?
»Dein Bruder wählte sein Schicksal selbst, Cohen«, sagte der König und beugte sich wieder über seine Arbeit. Er musste viele Bittsteller abwehren, noch bevor sie vor den Thron treten konnten, sonst würde er vermutlich niemals den Thronsaal verlassen. Zu viele Menschen kamen her und knieten vor ihm, um ihn um seine Gunst anzuflehen.
Cohen blickte hinaus und dachte daran, dass er seinen Bruder nicht einmal anständig begraben hatten dürfen, oder verbrennen. Keines der beiden in Nohva zugelassen Bräuche wurde einem Sünder zugeschrieben. Sevkins Überreste waren grausamer Weise den Hunden zum Fraß vorgeworfen worden, die Cohen seitjeher nicht mehr ansehen konnte.
»Ich hätte mit ihm hängen sollen«, flüsterte Cohen voll seelischem Schmerz.
König Rahff donnert die Faust so unerwartet fest auf seinen massiven Holztisch, das Cohen zusammenschrak und sich verwundert nach ihm umblickte.
»Jetzt genügt es aber, Sohn!«, warnte der König. »Denkst du wirklich, es hätte mir nicht das Herz gebrochen, ihn hängen zu sehen? Glaubst du das wirklich ?«
Cohen schüttelte den Kopf. Er versuchte angestrengt, nicht zu weinen, denn er wollte vor seinem Vater nicht schwach erscheinen. Obwohl er von Geburt an nahe am Wasser gebaut war – wie man so schön umgangssprachlich Heulsusen bezeichnete – achtete er stets darauf, wenigstens nicht in der Öffentlichkeit seine Schwäche zu zeigen.
Rahff hatte keine Tränen in den Augen, als er wütend erklärte: »Cohen, dein Bruder hat sich selbst in diese Lage gebracht. Ich konnte nichts tun, um ihm zu helfen. Sevkin war naiv genug, zu glauben, er könnte tun, was er wollte. Ohne Konsequenz. Aber er wurde eben erwischt.«
»Du hättest die beiden Stadtwachen der Lüge bezichtigen können!«, herrschte Cohen seinen Vater wütend an. Zum Glück waren sie allein im Raum, sonst hätte er sich für seine Unverschämtheit von seinem Vater eine ordentliche Standpauke anhören können.
Doch sie waren allein, also blieb Rahff ganz ruhig, als er erwiderte: »Die beiden Männer von der Stadtwache haben schließlich nur das getan, wozu sie ausgebildet wurden. Sie meldeten ein Verbrechen, Cohen. Das weißt du. Ich wollte meinen Sohn nicht hängen sehen, das weißt du ebenfalls, aber mir waren die Hände gebunden. Dein Bruder hat ein Verbrechen in den Augen unserer Kirche begannen. Dafür hat er die gerechte Strafe erhalten.«
Cohens Lippe zitterte, als er erstickt fragte: »Glaubst du das denn wirklich?«
Gerechte Strafe? Für was? Was hatte Sevkin denn so Schlimmes getan in den Augen der Gläubigen? Cohen war gläubig – war es gewesen – und für ihn war das, was Sevkin getan hatte, nichts im Vergleich zudem, was er und seine Männer die letzten Jahre auf dem Schlachtfeld verbrochen hatten. Sevkin hatte zumindest nie jemanden getötet.
»Nein«, gab Rahff zu. Er legte seine Schreibfeder sorgsam nieder und rieb sich die Stirn, als habe er Kopfschmerzen. Dann erhob er sich und ging auf Cohen zu. »Hör mir zu, Cohen. Du weißt, dass ich nichts tun konnte. Schavellen hat es erfahren und auf die Hinrichtung gedrängt. Hätte ich meinen Sohn verschont, nur auf Grund dessen, weil er mein Sohn war, hätte Lord Schavellen die Bevölkerung gegen uns aufgebracht. Und was wir jetzt am wenigsten brauchen können, wären noch mehr Menschen, die sich bekämpfen. Der Bürgerkrieg muss enden, Cohen, und nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Es tut mir weh, dass mein Sohn dafür starb, aber Sevkin wäre auch gestorben, hätte ich mich geweigert, seine offensichtliche Schuld anzuerkennen. Das weißt du. Sie hätten uns alle gehängt. Das hätte dein Bruder nicht gewollt.«
Cohen verstand es ja, doch er wollte es nicht wahrhaben. Sein Bruder war gehängt worden, und niemand konnte ihn je wieder zurückbringen. Er war tot. Unwiederbringlich tot.
Cohen machte dieser Gedanke wahnsinnig vor Kummer.
Sie verloren Männer auf dem Schlachtfeld, und jetzt auch noch zu Hause. Er erkannte den Sinn dahinter einfach nicht. Wieso meinten es die Götter so übel mit ihm?
Der König blieb vor Cohen stehen und legte ihm mit einem Seufzen beide Hände in den Nacken. Sie waren kalt, trotz, dass die Hitze im Raum stand, wie in einer gutbetriebenen Küche.
»Cohen, das Fundament meiner Herrschaft besteht aus dem Bündnis mit Schavellen. Und er ist mit dem Kirchenoberhaupt nun mal stark verbunden. Wir müssen uns der Kirche beugen, auch, wenn sie uns alles nimmt, was wir lieben«, erklärte der König traurig. Er beugte sich zu Cohen und flüsterte, als seien seine nächsten Worte ein Geheimnis, dass er nur mit seinem Sohn teilen wollte: »König zu sein heißt, die eigenen Bedürfnisse zu vergessen, zum Wohle seines Volkes. Mein Vater hat es begonnen – und ich muss es jetzt ausbaden, wie es so schön heißt. Ein wenig Einfluss habe ich, aber stell dir vor, wie Nohva wäre, würde auch mein Wort nicht mehr zählen. Stell dir Nohva mit Schavellen als König vor.«
Nohva sähe aus wie Dargard, wusste Cohen, wenn Rahff nicht mehr da wäre.
Einst war Dargard, zu Zeiten des Airynn Königs, die kulturreichste Hauptstadt gewesen. Dort war jedes Volk vertreten gewesen, bis Schavellen Dargard übernahm. Seitdem waren dort immer wieder »Säuberungen« der Stadtviertel vorgenommen worden. In Dargard lebten jetzt nur noch Menschen von edlem Blut. Die wenigen verbliebenen Luzianer, die noch lebten, schlugen sich außerhalb der Stadt in halb zerstörten Dörfern durch. In Dargard war kein Platz für Mischlinge, Bastarde, Anderlinge oder Bettler. Das wirkte sich natürlich auch auf die Adeligen aus. Denn ohne Bauern gab es auch keine Ressourcen. Dargard lebte davon, Vorräte von anderen Ländereien zu kaufen. Das konnte vielleicht bei einer Stadt gut gehen, aber nicht bei einem ganzen Land. Nicht auf Dauer.
Cohen schüttelte verdrossen den Kopf und machte sich von seinem Vater los. Er schritt durch den relativ schmucklosen Raum, der für einen König nicht angemessen genug schien. Es gab mehr Praktisches als Prunkvolles in den Gemächern des Königs, der sich nichts aus Reichtum machte. Rahff wollte nur eines: regieren. Und das tat er, so gut er konnte, auch mit Erfolg.
»Wir müssen die Schavellens loswerden«, sagte Cohen, überrascht von seinen eigenen harten Worten. »Sie hintergehen dich und versuchen mittlerweile nicht einmal, es heimlichzutun.«
Der König setzte sich wieder in seinen rotgepolsterten Stuhl. »Vielleicht müssen wir das gar nicht. Es genügt manchmal auch, abzuwarten.«
Der unterschwellige Ton in der Stimme seines Vaters, ließ Cohen aufmerken. »Wie ist das gemeint?«
König Rahff grinste listig. »Meine Vögelchen zwitscherten etwas von geplanten Angriffen der Rebellen auf Schavellens Ländereien. Ich sage nicht, wir sollten unsere Verbündeten im Stich lassen, aber … wir haben es eben einfach nicht gewusst.«
Cohen überdachte dies einen Augenblick, schüttelte aber den Kopf. »Die Rebellen sind nicht zahlreich genug, um Schavellen wirklich zu überrennen.«
Читать дальше