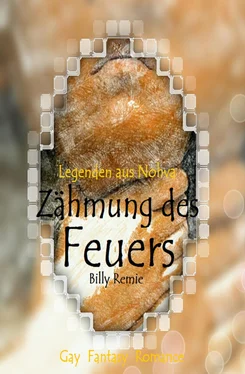Ja, dafür waren sie gut. Nicht auszudenken, die Soldaten des Lords von Dargard würden mal einen feindlichen Soldaten gegenübertreten müssen, statt unschuldige Zivilisten zu ermorden, dachte Cohen zynisch.
»Wir brauchen Rüstungen und neue Waffen für den Frühling«, hatte Lord Schavellen dem König vorgetragen. »Uns fehlen Ressourcen, wir haben keine Wahl, wir müssen uns finanzielle Mittel beschaffen.«
Kriegsbeute nennen sie es. Cohen nannte es Plündern. Wenn man im Krieg eine bedeutende Stadt des Feindes erobert, sie einnimmt und dann die darin befindlichen Güter für die eigenen Armeen verwendet, war dies unabdingbar. Doch einen ungeschützten Tempel auszurauben und die Heiligtümer zu stehlen war ein Kriegsverbrechen in Cohens Augen. Zumal sie damit nur noch mehr die Wüstenbevölkerung gegen sich aufbrachten.
Solran betrachtete das Gemetzel innerhalb der Tempelanlage, als die ersten Soldaten der Ebenen durchbrachen und die ersten qualvollen Schreie der Unschuldigen laut wurden. Er schüttelte leicht den Kopf voller innerlicher Abscheu, dabei wackelte sein grauer Haarschopf.
»Ja«, flüsterte Solran in die Morgenröte hinein, »für Ehre und Ruhm unseres Königs …«
»Was hat das noch mit Ehre zu tun?«, ließ Arrav verlauten. Er war ein grimmiger Geselle, groß und schlank – zu groß für seinen kleinen weißen Hengst – dessen dunkles Haar in Wellen auf seine Schultern fiel.
Als Cohen sich im Sattel mit nachdenklichem Blick zu ihm umwandte, schnitt er gerade in aller Seelenruhe mit einem Dolch ein Stück von einem hellgrünen Apfel ab und schob es sich in den Mund.
Arrav hatte keine Probleme damit, zu töten, er war Cohen immer sehr kaltherzig erschienen, doch nachdem sie in den letzten vier Jahren zusammen zu Felde gezogen waren, wusste Cohen, das Arrav nicht kalt, sondern nur abgestumpft war. Arrav kannte den Unterschied zwischen Töten und Morden. Etwas, das die Soldaten unterhalb dieses Sandhügels vergessen hatten.
Cohen sah sich weiter nach seinen Männern um. Es waren fünf, die ihm unterstanden. Solran, der mehr ein Mentor als ein Untergebener war. Arrav, der im Herzen mehr wie ein kalter Meuchelmörder aber ein treuer Gefährte war. Iksbir, der ein erstaunlich diplomatisches Gespür besaß. Ugrath, Iksbirs jüngerer Bruder, der vom Töten eigentlich nichts hielt und nur kämpfte, weil er dazu gezwungen war. Und schließlich Misa, der so jung war, dass er in Frauenkleider locker mit einem Mädchen zu verwechseln wäre. Nicht einmal in den Stimmbruch war der Junge gekommen, bevor er in die Armee gesteckt wurde.
Fünf , von ursprünglich sechzig Mann. Sie waren nur noch fünf …
Eigentlich vier, denn der fünfte im Bunde, Misa, war in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Ein Junge im Alter von gerademal zwölf Sommern, der am Abend zuvor noch große Reden geschwungen hatte, welch guter Reiter und Kämpfer er wäre, und der nun, so kurz vor der Schlacht, wie ein nasser Sack im Sattel hing und blass um die zierliche Nase wurde.
Während der Junge voller Angst das Plündern betrachtete, sahen die anderen vier Cohen entschlossen entgegen. Ja, sie verabscheuten, was dort unten geschah, aber sie würden kämpfen. Weil sie ihn nach all den Jahren als Kommandanten respektierten, so wie er sie respektierte. Der Krieg hatte sie zu Brüdern gemacht, ihre Lebensumstände verbanden sie alle miteinander. Sie wussten, dass er der beste Reiter in ganz Nohva war, und sie vertrauten auf seine Fähigkeiten. Außerdem würde der König sie allesamt hinrichten lassen, wenn sie Cohens Befehlen nicht gehorchten.
Doch was anfangs der Grund für ihr Folgen war, war heute bereits vergessen. Sie ritten an Cohens Seite, weil er sich vor ihnen bewiesen hatte. Und er wollte sie jetzt nicht enttäuschen.
Voller Unbehagen blickte er wieder hinab und sah zu, wie Blut und Tod den hübschen Tempel besudelte. Auf den weißen Stufen, die zum Heiligtum hinaufführten, lagen eine Handvoll verstreuter Leichen, kein Soldat war unter ihnen. Einige Priester und Dienerinnen schafften es aus der Tempelanlage und flohen in die unerbittliche Weite der Wüste. Cohen hatte den Befehl, jeden Flüchtigen abzufangen und zu töten.
Das war nicht richtig.
Wofür kämpfen wir?
Er wusste es nicht.
Jedenfalls nicht dafür. Nicht, um die reichen Männer noch reicher zu machen. Nicht, um unschuldige Dienerrinnen und Priester abzuschlachten.
Cohen sah all seine gefallenen Kameraden vor sich, so als wäre es erst wenige Augenblick her. Über Fünfzig seiner Männer hatte er verloren, obwohl er für jeden einzelnen von ihnen sein Leben riskiert hatte. Es hatte nichts genützt. Die Götter hatten ihre schützenden Hände nur über ihn, jedoch nie über seine treuen Gefährten gehalten.
Seine Brüder hatte Cohen auch nicht retten können. Raaks, einstiger Kronprinz, starb in der ersten Schlacht gegen die Goldis mitten in den Tiefen Wäldern. Aber nicht durch Feindeshand. Ein Dämon ergriff von Raaks besitz, der Kronprinz war besessen und richtete in seinen eigenen Reihen ein Blutbad an, das sie fast den Sieg kostete. Cohen war gezwungen gewesen, ihn zu töten.
Und Sevkin, sein geliebter Sevkin, so jung und voller Lebensfreude, war seiner eigenen Naivität zum opfergefallen. Und Cohen war nicht dort gewesen, um ihn zu schützen.
Das konnte und würde er sich nie verzeihen. Cohen sah immer wieder Sevkins totes, blaues Gesicht vor sich …
»Nein.« Cohen schüttelte den Kopf und packte die Zügel. »Ich mach da nicht mehr mit!«
Damit riss er Galia herum und ritt unter den ungläubigen Blicken seiner Männer zurück zum Lager. Sie hatten ihn absichtlich provozieren wollen, doch hätten sie nie gedacht, dass er sich gegen den Willen der Kirche stellen würde. Das sah er ihren Blicken an.
Trotz, dass Cohen den König bei allem unterstützen wollte, was dieser entschied, hatte Cohen auch seine eigenen Prinzipien. Und diese konnte er nicht einfach vergessen. Er war kein Mörder und er würde niemals einen Unbewaffneten töten. Das verbot ihm der Eid, den er und seine Männer einst dem Gott der Gnade geleistet hatten. Und nichts konnte einen gläubigen Mann mehr in Furcht versetzen als den Zorn seiner Götter.
***
Auf den eigenen Tod zu warten konnte überaus langweilig werden. Das einzige, was man tun konnte, war abzuschätzen, wie man letztlich sterben würde.
Würde es der Galgen werden? Enthauptung? Was blühte einem Dieb?
Oder kam es erst gar nicht zur Hinrichtung, weil in den Gemäuern des königlichen Kerkers eine Krankheit umging, die nicht nur dazu führte, dass sich über die Hälfte der Gefangenen alle paar Augenblicke übergeben mussten, sondern die letztlich auch sehr rasch zum Tod führte.
Eagle lehnte in seiner Zelle an der hinteren Wand, zu seiner Rechten befanden sich die massiven von Rost überzogenen Gitterstäbe der Nebenzelle.
Als er hierhergekommen war – besser gesagt, als er hier hereingeworfen worden war – hatte er noch eine Zelle für sich allein gehabt. Mittlerweile war der Kerker überfüllt und er teilte sich seinen »Freiraum« nun mit einem Dutzend weiteren Gefangener. Es handelte sich dabei größtenteils um betrunkene Penner, die ihre Ausscheidungen seit Ausbruch der Krankheit nicht mehr bei sich behalten konnten.
Selbst Schweine waren sauberer, die Tiere nutzten nur eine Ecke, und machten nicht einfach dorthin, wo sie sich gerade befanden.
Zugegeben, einige von denen, die mit Egale in der Zelle saßen, waren außer Stande, sich zu bewegen, und konnten nichts dafür. So schwach wie sie waren, würden sie nicht mehr lange durchalten. Und dann wurde es erst richtig unschön, denn die Wachen kamen nur noch selten her, aus Angst vor der Krankheit, also blieben die Toten einige tagelang hier sitzen.
Es gab kaum Essen und wenig zu trinken. Die einzigen, die regelmäßig kamen, waren die Ratten und die gepanzerten Ritter, die Eagles einzigen Gesprächspartner tagein und tagaus aus der Zelle zerrten, ihn folterten, sodass seine qualvollen Schreie durch den gesamten Kerker echoten, und ihn dann wieder zurück in die einzig leere Zelle neben Eagle warfen. Der Mann aus der Nebenzelle war der einzige, der allein blieb. Warum, erriet Eagle nicht, doch er hatte die leise Ahnung, dass die Wachen und Ritter Angst vor dem Mann hatten.
Читать дальше