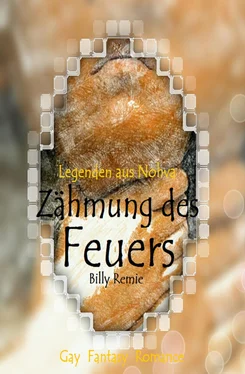Die Rebellen waren zwar eine mittlerweile beängstigt große Gruppe geworden, jedoch ohne Vorräte und mit schwindendgeringen Waffen und Rüstungen. Der größte Krieg spielte sich zwischen König Rahffs Truppen und dem völlig außer Kontrolle geratenem Wüstenvolk ab, das von ihren Feinden nur noch »Goldis« genannt wurde. Und das nicht nur wegen ihrer bronzefarbenen Haut, sondern vielmehr wegen den erst vor einigen Jahren entdeckten Golderzadern unterhalb der Wüste.
Gold war mehr wert als Silber, doch Cohens Glaube verbot Gold als Zahlungsmittel, da Gold in seinem Glauben allein den Göttern gehörte. Cohens Glaubensbrüder errichteten Kirchen und heilige Schreine aus Gold, opferten Gold, indem sie es in Truhen verschanzten und an heiligen Stätten für die Götter vergruben, in voller Hoffnung, so die Gunst der heiligen Wesen zu erlangen.
Doch die Goldis glaubten nicht an Götter. Sie beteten nur zu einem Gott. Einem Gott, der noch grausamer sein konnte als Cohens eigene Götter.
Sie waren bereit gewesen, das Gold für den König abzuschürfen und es zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, so wie es ihr gutgegebenes Recht gewesen wäre, immerhin gehörten diese Minen ihnen. Aber ihr Vorschlag wurde abgelehnt.
Wie dem auch sei. Das Gold war der eigentliche Grund, weshalb Lord Schavellen – Lord von Dargard – Krieg beginnen wollte. Natürlich im Namen der Götter. Und auch König Rahff war ebenso erpicht darauf, die Minen für sich zu beanspruchen, doch einem Krieg hätte er rein aus finanzieller Sicht wohl kaum zugestimmt, wenn ihn Lord Schavellen und sein sadistischer Sohn nicht dazu erpresst hätten. Wie so oft hatte sich der König Nohvas von den Anhängern der Kirche unterdrücken lassen, weil seine Herrschaft davon abhing, dass er von den Gläubigen unterstützt wurde.
Cohen konnte all das überhaupt nicht verstehen, von Politik hatte er ohnehin keine Ahnung. Aber er sah mehr als die hohen Köpfe, die im Hintergrund die Fäden zogen. Er war ein Krieger mitten in den Schlachten, und er, als einfacherer Soldat, wusste mehr als jeder Adelige, dass es den Männern und Frauen der Völker nicht um Gold ging. Nein, das alles hier, der gesamte Krieg – zusätzlich zum Aufstand der Rebellen – war in einen heiligen Krieg ausgeartet. Götter gegen einen Gott. Religion gegen Religion. Ein Glaube gegen einen anderen. Am Rande des Krieges kämpften die Rebellen für etwas Freiheit, die sie wohl nie erlangen würden, und die großen Heere schlugen sich gegenseitig die Köpfe ab, während die Götter, für deren Rechte sie töteten, vermutlich gar nicht mehr existierten.
Cohen war einst ein Mann gewesen, der ohne nachzufragen alles im Namen der Götter getan hätte. Er war sehr gläubig gewesen, obwohl sein eigener Glaube ihn unterdrückte. Er war nur ein Bastard, und als Bastard war man in den Augen seiner Götter nichts wert, also hatte er nie zu etwas Höherem aufsteigen können als zu dem, was er heute war. Er durfte einen kleinen Reitertrupp anführen, aber nur, weil er des Königs Bastard war, und nur, weil die Männer, die ihm unterstanden, ebenfalls Bastarde waren.
Sie waren die Schandflecke ihres Volkes, und doch waren sie es, die immer wieder ihr Leben zum Schutze jener riskierten, von denen sie verurteilt wurden.
Wie gesagt, Cohen war ein gläubiger Mann gewesen. Nicht einmal der Umstand, dass er niemals die Truppen seines Vaters anführen würde – wie der König es ihm als Kind stets versprochen, aber nie eingehalten hatte – hatte daran etwas ändern können. Doch nun, nach dem Winter und nur wenige Augenblicke vor einer weiteren Schlacht, musste Cohen sich eingestehen, dass er in seinem Glauben erschüttert worden war.
Denn der Glaube an die Götter war schuld, dass er vor wenigen Monaten seinen letzten noch verbliebenen Bruder verloren hatte. Einen Bruder, den er mehr geliebt hatte, als sein eigenes verfluchtes Leben.
Cohen spürte Solrans Blick auf sich. Der Reiter war viele Jahre älter als Cohen und hätte es verdient, an Cohens Stelle zu stehen. Aber wie gesagt, Cohen war der Befehlshaber, weil er nicht irgendein Bastard war, sondern des Königs Bastard.
Zu irgendwas musste dieser winzige Unterschied ja gut sein.
Cohen wandte seinem Kameraden nicht das Gesicht zu, er starrte weiter hinab auf die Tempelanlage, nur seine düsteren Gedanken lichteten sich etwas.
Es war Zeit, sich zu konzentrieren, es stand ein Kampf bevor.
Solran betrachtete Cohen noch eine ganze Weile nachdenklich, erst dann richtete er seinen Blick ebenfalls auf die Tempelanlage und betrachtete die aus weißem Stein gefertigten Türme, deren Spitzen im Morgenrot golden schimmerten.
»Wofür kämpfen wir eigentlich?«, flüsterte Solran in die milde Morgenluft. »Für Lords, die Bastarde und Frauen unterdrücken? Für eine Heimat, die von Ausbeutung gekennzeichnet ist? Kämpfen und sterben wir für Männer, die uns gar nicht wahrnehmen?«
Cohens Lippen öffneten sich unwillkürlich, weil seine Brust und Kehle bei diesen Fragen so eng wurden, dass er zu ersticken glaubte.
Ihm wurde von seinen Männern in letzter Zeit oft diese Fragen gestellt, als spürten sie, dass er ihnen nach dem Tod seines letzten Bruders näher war denn je.
Denn vor Sevkins Ermordung – und für Cohen war es nichts als Mord gewesen – waren sie gegenüber Cohen eher distanziert gewesen, nach dem Winter jedoch waren ihre Blicke und Worte voller Respekt gegenüber ihrem Kommandanten.
Früher hatten sie ohne ihn getrunken und getuschelt, und wenn er in ihre Nähe gekommen war, waren sie verstummt und hatten sich vielsagende Blicke zugeworfen. Ganz nach dem Motto: »Er ist des Königs Bastard, sagt bloß nichts Falsches!«
Als Cohen nach einem längeren Aufenthalt in seinen Gemächern – angeblich musste er sich von einer schlimmen Verletzung erholen – wieder freigelassen wurde, hatte sich seine ganze Welt verändert. Und auch seine Männer. Denn sie wussten, dass er in keiner Schlacht verletzt worden war. Sie ahnten, dass er unfreiwillig weggesperrt worden war. Sicher fragten sie sich, was im Winter in der königlichen Burg tatsächlich geschehen war, aber keiner drängte danach, es von ihm bestätigt zu bekommen.
Fakt war, ihr Kommandant wusste selbst nicht mehr, wohin er gehörte, und das war ihre Chance, ihn an ihren Gedanken teilhaben zu lassen.
Wie immer konnte Cohen die Frage darüber, wofür sie heute kämpften, nur mit einer lieblosen Erwiderung beantworten, die ihm sein Vater eingefleischt hatte.
»Wir kämpfen für unsere Heimat. Für die Ehre und den Ruhm unseres Königs«, murmelte er gedankenverloren.
Er liebte seinen Vater, er schätzte ihn wie keinen anderen Mann. Ihre Verbindung war stark, ihr Verhältnis war einmalig und lobenswert. Cohen mochte nur die Hintermänner nicht, die seinen Vater erpressten.
Warum, verflucht noch mal, hatte er nicht den Tod seines letzten Erben verhindert?
Cohen schloss die Augen und versuchte, jetzt nicht an Sevkin zu denken, oder daran, wie er auf den verlassenen Platz getreten war, mutterseelenallein, über verfaultes Obst und Dreck gestolpert war, um auf den Galgen zu klettern und den Körper seines Bruders loszuschneiden. Er wusste noch, wie angeschwollen und blau Sevkins feine Gesichtszüge gewesen waren, und wie ihm die dicke Zunge aus dem lieblichen Mund gequollen war, als wäre sie ein Fremdkörper und könnte unmöglich zu ihm gehören.
Seine Erinnerung daran wurde brüsk unterbrochen, als die ersten Soldaten über die Sandhügel rannten und auf die Tempelanlage zusteuerten, kurz darauf waren die Warnrufe von Dienerinnen zu hören. Die Fußtruppen machten den ersten Vorstoß, nach ihnen brachten einige Soldaten einen Rammbock, um die massiven Tore der Mauern aufzustoßen, damit sie ungehindert in den Tempel eindringen konnten.
Cohen und seine Männer waren erst dann gefragt, wenn wiedererwarten Soldaten in der Tempelanlage versteckt waren.
Читать дальше