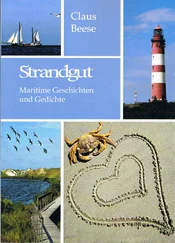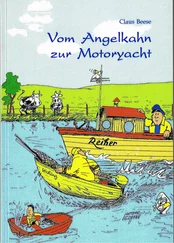„Das macht er immer so", erklärte der Wachhabende. „Dürfen wir Sie zum Essen einladen? Der Grill steht schon bereit, und es ist genug für alle da.”
Ich willigte dankbar ein und war mir sicher, dass dies der Beginn einer langen Freundschaft war. Was konnte man sich Schöneres zu Weihnachten wünschen?
Von Klaus-Dieter Welker
Wollte man den Statistiken Glauben schenken, dann gab es ihn eigentlich nicht. Junge Studenten hatten sein Dasein unmöglich gemacht. Mit spitzer Feder, mit Hochleistungsrechnern und anderem intelligenten Unfug hatten sie errechnet, wie schnell er sein musste, um jedes Kind an Weihnachten zu bescheren. Wie viele Rentiere er vor seinen Schlitten spannen musste, um die ganzen Geschenke in der Christnacht transportieren zu können, und dass diese – und dann auch er – bei der errechneten wahnwitzigen Geschwindigkeit letztendlich verdampfen würden. Er schüttelte den Schnee von seinem Mantel und schaute auf seine Rentiere. Natürlich „dampften“ sie ein wenig. Das war ja auch kein Wunder, die kalte Luft ließ den Atem vor ihren Mäulern kondensieren. Aber von einem „Verdampfen“ konnte gewiss keine Rede sein.
Was wussten diese jungen Hüpfer schon von den Wundern der Weihnacht? Bei ihnen musste alles berechenbar, messbar und in Zahlen belegbar sein. Da fing das ganze Unglück ja an. Kaum waren die Menschen alt und klug genug, um zu rechnen und zu schreiben, begannen sie, sich als „allwissend“ zu betrachten. Und je älter und „klüger“ sie wurden, desto weniger glaubten sie an die Wunder dieser Welt. Es war also nur eine Frage der Zeit bis sie auch ihn aus ihren Gedächtnissen gerechnet hatten, keine Briefe mehr mit ihren großen und kleinen Wünschen an ihn schickten und darauf vertrauten, dass er sie, so gut es eben möglich war, erfüllen würde. Und gar zu viele erzählten ihren Kindern überhaupt nicht mehr von ihm, sondern mieteten sich gleich einen „Weihnachtsmann“, der ihn ersetzen sollte. Vielleicht würde es nicht mehr lange dauern, bis er überflüssig wurde.
Nein, das waren zu trübe Gedanken für diese Nacht. Noch war es nicht so weit, noch gab es Menschen, die an ihn glaubten. Und die wollte und durfte er nicht enttäuschen. Er schaute auf seine Liste, die in den letzten Jahren immer kürzer geworden war. Da mussten diese jungen Studenten mal dringend ihre Berechnungen aktualisieren, dachte er wehmütig schmunzelnd. Die Zahlen, die sie zugrunde gelegt hatten, waren längst überholt. Ja, früher einmal...
„Ach was, hör auf damit“, schimpfte er sich selbst.
Der nächste auf seiner Liste war Paul. ‚Sankt-Vincent-Heim‘ hatte in Schönschrift auf dem Brief gestanden, der an ihn adressiert gewesen war. Das war selten geworden; inzwischen schrieben ihm die Menschen mit Computern oder Schreibmaschinen. Oder sie legten ihren Wunschzettel auf das Fensterbrett – falls sie ihn nicht gleich ihren Eltern, Ehegatten oder sonstigen Verwandten gaben, damit die wussten, was sie im nächsten Juwelier-, Spiele- oder Geschenkladen einzukaufen hatten.
„Lieber Weihnachtsmann“, hatte in dem Brief von Paul gestanden, „ich wünsche mir so sehr, dass Heinrich wieder eine gute Arbeit findet, damit Ulrike nicht mehr arbeiten muss und wieder mehr Zeit für mich hat. Und dass ich dann vielleicht wieder nach Hause kann. Ich vermisse die beiden so sehr. Hier bin ich ganz allein, obwohl ganz viele andere auch hier sind. Aber die haben meistens keine Zeit für mich. Die meiste Zeit bin ich alleine in meinem Zimmer und nach draußen darf ich nur, wenn eine Schwester dabei ist. Aber die müssen sich ja noch um so viele andere kümmern. Bitte, bitte! Du kannst bestimmt eine Arbeit für Heinrich finden. Und wenn das nicht geht, könntest du dann vielleicht machen, dass sie mich öfters besuchen kommen?
Viele Grüße an das Christkind. Dein Paul.“
Der Brief war ordentlich und ohne Fehler geschrieben. Entweder ist er ein kluges Bürschchen, oder es hat ihm einer geholfen, dachte er. Nur die Wasserflecke unter „Dein Paul“ passten nicht dazu.
„Tränen“, dachte der alte Mann. Er hatte lange gegrübelt, als er den Brief gelesen hatte. Nein, ein Paul aus einem ‚Sankt-Vincent-Heim‘, war ihm nicht bekannt. Er hatte sich auch die Briefe der letzten Jahre angeschaut. Da war keiner von dem kleinen Paul dabei. Es schien also ein neuer „Kunde“ zu sein. Da musste er sich besondere Mühe geben.
Das ‚Sankt-Vincent-Heim‘ lag abseits der kleinen Stadt. Die meisten Fenster waren dunkel; nur im Treppenhaus brannte Licht. Es war wohl nur eine kurze Weihnachtsfeier gewesen und die Kinder lagen bestimmt schon in ihren Betten. Eigentlich schade, aber es erleichterte ihm seine Aufgabe, ungesehen dort hinein zu kommen. Ach Quatsch – sehen konnten ihn ja doch nur jene, die auch an ihn glaubten. Und außer von dem kleinen Paul hatte er keinen Brief oder Wunschzettel erhalten.
Entgegen der weit verbreiteten Meinung, er müsste durch den Schornstein rutschen, um in ein Haus zu kommen, hatte er das nicht nötig. Geschlossene Türen gab es für ihn nur dort, wo er nicht erwünscht war. Und so spazierte er durch die große Eingangstür, die sich bereitwillig vor ihm öffnete, stiefelte an der verglasten Empfangsloge vorbei, in der eine ältere Dame in einem Modemagazin blätterte und stieg unbemerkt die breite Treppe hinauf. Das war auch eines der Dinge, die sich die jungen Studenten, die ihn aus dieser Welt heraus gerechnet hatten, nicht erklären konnten, dachte er. Er fand seinen Weg ohne neumodische Navigationsgeräte oder Wegbeschreibungen. Sein „Navi“ – wie sie es nannten – war sein Herz, sein Gespür und sein Wunsch, die Menschen an diesem Tag glücklich zu machen. Nun, besser wäre es noch, sie für längere Zeit zu beglücken. Aber das gelang nicht immer. Die Menschen standen ihrem Glück oftmals selbst im Wege.
Oben begegnete ihm eine ältere Dame im weißen Kittel, die mit ärgerlichem Gesicht und einer Garnitur frischer Bettwäsche an ihm vorbei eilte, ohne ihn auch nur mit einem Blick zu bedenken. Dabei war er ein stattlicher Mann und in seinem rotem Mantel, seinem langen, weißen Bart und dem großen Sack über seiner Schulter gewiss ein ungewöhnlicher Anblick. Schon wieder eine, die nicht an ihn glaubte.
Grummelnd verschwand die Weißbekittelte in einem der Zimmer. Da war wohl einem der Kleinen ein Unglück passiert. Eigentlich kein Grund, mit so bösem Gesicht durch die Gänge zu streifen, dachte er. Wem war das als Kind nicht passiert? Außerdem war Weihnachten. Das Fest der Freude. Aber hier in diesem „Heim“ war wenig davon zu spüren. Vielleicht – ja, vielleicht müsste er hier öfters einmal vorbeischauen. Und wenn er dann doch durch den Schornstein rutschen musste, weil er „unerwünscht“ war: nun, dann müsste er es eben tun. Da hätten die jungen Herren Studenten dann wieder genügend zu berechnen, um die Unmöglichkeit zu beweisen, dass ein Mann mit seiner Statur durch die heutigen Schornsteine passte. Und ob er das schaffen würde.
Er schritt weiter durch den langen Gang, der nur dürftig von einer Notbeleuchtung erhellt wurde. Er war fast da, das spürte er ganz deutlich. Dort, hinter der nächsten Tür, wartete der kleine Paul auf ihn, der wohl auch sein Kommen spürte, denn noch bevor er sie erreichte, wurde sie von innen geöffnet.
Ein paar große, vor kindlicher Freude strahlende Augen starrten ihn an. Pauls Mund stand vor Staunen ein wenig offen, als er den Weihnachtsmann erblickte. Dann legte er schnell einen Zeigefinger vor die Lippen um ihm zu bedeuten, ja leise zu sein und winkte ihn aufgeregt in sein Zimmer.
„Die Schwestern schimpfen bestimmt, wenn sie dich sehen“, flüsterte er. „Nach dem Zu-Bett-Gehen darf nämlich keiner mehr in die Zimmer kommen.“
Hastig zog er die Tür hinter sich ins Schloss und strahlte den Weihnachtsmann wieder an.
Читать дальше