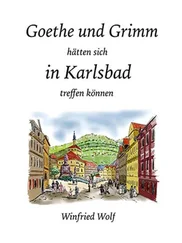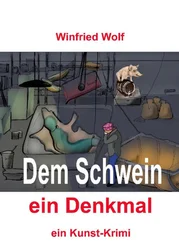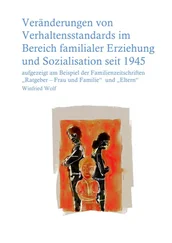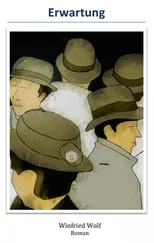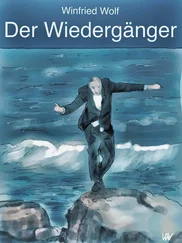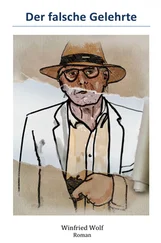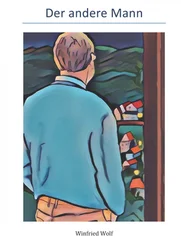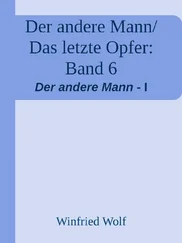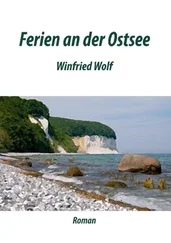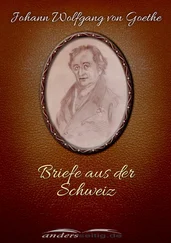Die Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, Katharina hatte keinen Gesprächs- und Briefpartner, mit dem sie so ungezwungen reden und korrespondieren konnte wie mit Grimm. Grimm war von den Briefen Katharinas mitunter so elektrisiert, dass er nach dem Lesen ihrer Zeilen oft die halbe Nacht aufgewühlt in seinem Zimmer auf und ab gehen musste. Als Katharina ihn 1791 inständig darum bat, all ihre Briefe an ihn zu verbrennen, konnte er dieser Aufforderung nicht nachkommen, ein solches Opfer wäre über seine Kraft gegangen. Grimm konnte jedoch seine Korrespondenz sicher nach Deutschland bringen, nach seinem Tod wurden sie von russischen Kurieren nach St. Petersburg gebracht und liegen seitdem in russischen Staatsarchiven.
Welche Bedeutung kommt den Briefen von Grimm an Findlater zu?
Zunächst einmal muss gesagt werden, dass in den Briefen, ein erster Blick darauf könnte zu dieser Vermutung Anlass geben, nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht wurden. Was uns bei der Lektüre der Briefe vor Augen geführt wird, ist die ungeheure Fülle eines unaufhörlichen, nie versiegenden Austausches von Nachrichten zwischen Gotha und St. Petersburg. Friedrich Melchior Grimm ist Verteiler und Vermittler von Nachrichten aller Art. Er ist die Knotenstelle für Botschaften, Anfragen, Gesuche und Mitteilungen an Katharina II. Seine „boutique“, wie Grimm seine Schreibstube nennen würde, verbindet die Freunde Findlater und Romanzof mit der russischen Machtzentrale; Grimm gibt Richtlinien der Kaiserin an ihre ausländischen Gesandten weiter, über ihn ergeben sich Kontakte zwischen England und Russland, manchmal auch zwischen Ludwig XVIII., dem Exilkönig der Franzosen, und Katharina II.
Die Briefe an Findlater offenbaren uns Details zur dritten Teilung Polens, sie spiegeln die Rolle der franz. Emigranten in Deutschland wieder; wir erfahren interessante Details über die englisch-russische Politik zwischen den Jahren 1794 und 1801. In seinen Briefen diskutiert Grimm mit Lord Findlater die „beschämende“ Friedenspolitik ihres gemeinsamen Freundes Prinz Heinrich von Preußen, der mit seinen Denkschriften nicht wenig zum Frieden von Basel beigetragen hat. Grimm kommentiert die „Katastrophe“ von Quiberon und bedauert, dass England und Russland den Kampf gegen die Franzosen nur mit Worten, nicht aber mit Taten führen. Kritisch kommentiert wird auch die Politik Österreichs; Grimm, der nach wie vor in engem Briefkontakt mit Katharina II. steht, zeigt sich hier als Propagandeur seiner Herrin und kann kaum Sympathien für die Wiener Hofpolitik entwickeln.
Grimm verwaltet für Katharina die Hilfsgelder für franz. Emigranten in Deutschland. Bittgesuche gehen häufig über Grimms Adresse in Gotha und Grimm hat entscheidenden Einfluss auf die Verteilung der Gelder. Auch darüber erfahren wir zumindest in Andeutungen das eine oder andere interessante Detail. Grimm und Findlater waren jeder auf seine Art in der Unterstützung von Emigranten tätig: Findlater als großzügiger Spender und Grimm als Vermittler von Hilfsgeldern. Grimms ehemaliger „Vorgesetzter“ zu Zeiten des Siebenjährigen Krieges, der Marechal de Castries, gehört nun u.a. zu seinen „Schützlingen“. Auf Grimms Betreiben hin erhielten auch ehemalige Offiziere der royalistischen Armee Ludwigs XVI. in Russland eine neue Anstellung.
Mit Lord Findlater kann Grimm darüber sprechen, welche Chancen sein „Mündel“, der Graf von Bueil hätte, sich in Russland oder Kanada als Siedler niederzulassen; in dieser Angelegenheit kommen auch Anbaumethoden und die Aufzucht von Rindern zur Sprache, auf beiden Gebieten vermag sich Lord Findlater als Fachmann zu erweisen. Damit wird Findlater in die internen Angelegenheiten und Sorgen der „Familie“ seines Briefpartners einbezogen.
Findlater wird in Grimms Briefen auch gern als „Klagemauer“ benutzt. Ihm kann Grimm sein ganzes Elend schildern und das tut er ausführlich und mitunter recht larmoyant. Mal ist es die angegriffene Gesundheit, mal sind es die materiellen Verluste und die Einschränkungen in der Lebensweise, die Grimm und die Seinen hinnehmen mussten.
Aus seinen Briefen können wir auch Rückschlüsse auf Grimms psychische Verfassung ziehen. Als Diener der Höfe, musste sich Grimm stets als Person mit eigenen Befindlichkeiten zurücknehmen, seinem Freund Findlater gegenüber kann er sich erlauben auch, auf persönliche Schwächen einzugehen.
Grimm ist auf Gedeih und Verderb dem Wohlwollen und der Großzügigkeit der russischen Kaiserin ausgeliefert. Er hat keine eigenen Grundfesten, auf denen er bauen könnte, sie ist ihm der Stern in der finsteren Nacht. Diese Abhängigkeit unterscheidet ihn von seinem Briefpartner, der aus altem schottischen Adelsgeschlecht kommt, mit weltlichen Gütern reich gesegnet ist und selbstbewusst zu leben versteht. An Grimm fressen die Sorgen um seine „Familie“; was soll aus den Kindern werden, womit wird Graf Bueil einmal seine Familie ernähren können? Werden die eigenen Kräfte ausreichen, die nächsten Jahre zu überstehen, wird Katharina ihm auch in Zukunft zur Seite stehen? In Grimms Gefühlshaushalt mischen sich Trauer und Verlustängste, die angegriffene Gesundheit verstärkt das Gefühl von Schwäche und Ausweglosigkeit, die äußeren Ereignisse und politischen Verhältnisse bestätigen in einem Fort seine pessimistische Weltsicht und sein zögerlicher Charakter lassen ihn in einem Zustand verharren, der geradezu auf Erlösung wartet. Diese Erlösung kann für Grimm nur von außen kommen, jeder neue Brief aus St. Petersburg kann, so seine Hoffnung, die Wende zum Guten bringen.
Als ihn die Nachricht vom Tod der Kaiserin erreicht, ist Grimm am Boden zerstört. Mit ihrem Tod ersterben alle Hoffnungen auf eine Wende zum Guten. Die geplante und mehrfach angekündigte Reise nach Russland verliert ihren Zweck und ihr Ziel, Grimms Stellung am russischen Hof ist nun in Frage gestellt, die Hoffnungen auf eine Wiederherstellung der franz. Monarchie mit Russlands Hilfe können begraben werden, Geldsendungen aus Russland werden, so ist zu befürchten, ausbleiben und Grimm wird mit seiner „Familie“ ins Elend fallen - das sind Grimms Ängste. Doch Katharinas Nachfolger, Paul I., bestätigt die Berufung Grimms zum bevollmächtigten Minister für den niedersächsischen Kreis in Hamburg. Aber das ist nicht das, worauf Grimm gehofft hatte. Er fühlt sich dem Posten nicht gewachsen, er fühlt sich alt, ist krank und verfügt nicht über die Mittel, die er für die hohen Lebenshaltungskosten in Hamburg aufbringen muss. Wenige Monate nach Antritt seines neuen Amtes wird er so gut wie blind und er wird sich der Nutzlosigkeit seiner Dienste bewusst. Er bittet um seine Abberufung und kehrt über Umwege nach Gotha zurück. Seine letzten Briefe an Lord Findlater hat er nur noch seiner kleinen „Katinka“ in die Feder diktieren können. Grimm hat in seinem Leben wohl einige Tausend Briefe selbst geschrieben, seine Briefpartner waren über ganz Europa verteilt. Er korrespondierte mit fast allen Königen, Fürsten und Ministern, die etwas zu sagen hatten. Die Briefe an Lord Findlater erzählen über sein Leben in Gotha, es sind die Briefe eines Mannes, der an sein Ende gekommen war.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.