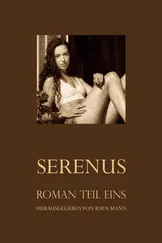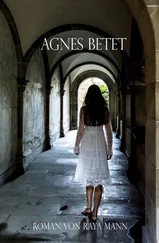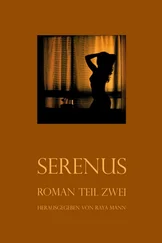Die Auswertung von ein bis zwei Millionen Handy-Nachrichten entsprach dem Bau eines gigantischen Elfenbeinturms. Weder die fleißigen Studenten noch die staunenden Kollegen fragten sich, auf welchen Gründen das ganze Konstrukt ruhte. Ein festeres Fundament war undenkbar. Mein Selbstbewusstsein als Wissenschaftlerin war erdbebensicher.
Das Grab meiner Liebe befand sich tief in der Erdkruste. Darüber lag das ganze Gewicht der Erdscheibe. Fortwährend drangen Erschütterungen an die Oberfläche und versetzten den Boden, auf dem ich stand, in Schwingungen. Ich hatte mich an sie gewöhnt und nahm sie nicht mehr wahr. Das intellektuelle Konstrukt aus versendeten und empfangenen sms ragte wie ein Denkmal für meinen Sieg über Schmerz und Leere in den Himmel.
Indessen, ich dachte nicht darüber nach, ob ich als Mittdreißigerin das bestmögliche Leben lebte, mit meinen Erfolgen als Assistenzprofessorin und mit meinem Single-Dasein in dem großen Haus an der Route de la Glâne. Ferner dachte ich auch nicht darüber nach, ob mir etwas fehlte – ein Mann an meiner Seite, ein Säugling an meiner Brust, ein Leben in einem anderen Land.
Nur zweimal schreckte ich auf. Das erste Mal in der Runde meiner Studenten, als wir über einen sms-Dialog aus dem i-Phone von Nicole, einer meiner Lieblingsstudentinnen, diskutierten. Magaly, ihre beste Freundin, lebte in Boston und studierte Ethnologie an der Harvard University. Beide waren mehrsprachig erzogen worden, tauschten sich aber auf deutsch aus. Nicole begann:
„ich denk nicht an dich“
„ich auch nicht“
„nicht denken“
„etwas anderes“
„nämlich?????“
Magaly reagierte jedoch nicht und Nicole fuhr selber fort:
„ich kann dich sooo gut riechen von usa bis hier. lol“
„transatlantische olfaktion?????“
„yep“
„glaub ich dir nicht“
Dazu ein Emoticon mit herausgestreckter Zunge und ein paar Minuten später die Aufforderung, Nicole solle ihr Beweise liefern:
„evidence!!!!!“
„du hast die mens. hmmm?????“
„go on!!!!!“
„hast die zähne noch nicht geputzt“
„drittens?????“
„du trinkst pulverkaffee“
„würg“
Magaly ließ offen, ob die Beweise zutrafen oder nicht. Vielleicht hatte sie tatsächlich ihre Periode, morgendlichen Mundgeruch und eine Tasse Instant Coffee vor sich. Nicole hörte dann auf zu schreiben. Im Seminar erklärte sie uns, dass sie an jenem Nachmittag eine Vorlesung hatte und sich auf den Weg machen musste. Als sie später ihr Handy gecheckt hatte, waren drei neue Nachrichten von Magaly eingegangen und ein Emoticon mit zwei tanzenden Mädchen, die offensichtlich Zwillinge darstellten:
„wir haben ein totem“
„du bist mein clan“
„hast du auch die maler im keller?????“
„yep, bin mit heinz, aber mega“, schloss Nicole.
Gemeint war die Monatsblutung. Heinz war die bekannte Ketchup-Marke.
Drei Dinge bestürzten mich damals: der intime Umgangston, die Metapher des Riechenkönnens und die Formel „ein Totem haben und ein Clan sein“. Meine Erinnerungen an verregnete Sonntage, die Serenus und ich im Bett verbracht hatten, unsere Neckereien und unsere Ausdünstungen, wenn wir zusammen Liebe gemacht und uns nach dem Orgasmus in den Armen gehalten hatten. Vor dem Frühstück holte Serenus manchmal zwei Gläser und eine Flasche Ladyburn, meinen Lieblingswhisky. Wenn wir beschwipst waren, plapperten wir über unseren Clan. Wir nannten uns den Clan Destiny, weil es unser Schicksal sei, ein Paar zu sein, und Clan-Destin, weil niemand von unserer heimlichen Heirat wusste. Wir liebten beide solche veralteten Wörter wie klandestin. Zu meinem dreißigsten Geburtstag hatte mir Serenus eine Fahrt den Mississippi hinunter geschenkt, mit dem Raddampfer von Memphis nach New Orleans. Von dort aus fuhren wir nach Valparaíso in Florida, wo wir uns trauen ließen. Unseren Honeymoon verbrachten wir auf der Halbinsel Destin. Daraus ergab sich der Name für unseren Clan.
Das zweite Mal schreckte mich Eva auf, als sie mich im Jahr 2008 oder 2009, genau weiß ich es nicht mehr, anrief. Über die Gerüchteküche unserer weitverzweigten Familie hatte sie von Serenus gehört. Es hieß, hinterbrachte mir Eva, er sei immer noch in Madrid und lebe zusammen mit einer Zwanzigjährigen, einer Prostituierten aus der Karibik, und deren kleiner Tochter. Ich unterbrach sie und nahm ihr das Versprechen ab, nie wieder etwas über ihn verlauten zu lassen.
Niemand – Serenus ausgenommen – hatte mich jemals als schöne Frau bezeichnet, schon gar nicht in meinen Dreißigern. Ich war einigermaßen groß und recht schlank: 172 Zentimeter und 63 Kilogramm. Ich hatte ziemlich lange Beine, die allerdings ein wenig krumm gewachsen waren, sodass ich nicht gern kurze Röcke trug. Meine Brüste waren winzig, denn schon nach meiner Menarche entwickelten sie sich nicht mehr weiter. Das Schönste an mir, fand ich, war mein Hintern. Dafür schämte ich mich für mein Bäuchlein, das ich auch mit Hungerkuren nicht wegbekam. Mein Kopf thronte auf einem zu langen und zu festen Hals. Mein Haar hatte keine richtige Farbe, es war weder dunkelblond noch braun. Dafür war es üppig und lang und reichte mir bis zu den Knien. Ich trug es immer noch zu einem dicken Zopf geflochten, der mir weit den Rücken hinunter hing. Leider hatten meine Augen einen merkwürdigen Schnitt, der mich immer traurig aussehen ließ und deren Form durch meine Weitsichtigkeit und meine Brille noch betont wurde. Dafür liebte ich ihre Iris – riesig und himmelblau mit einem Stich ins Grün-Grau. Ich sah nichts an mir, was ich sexy gefunden hätte, außer vielleicht das Lächeln meines großen Mundes mit seinen geschwungenen Lippen. Am schlimmsten fand ich meinen Unterkiefer. Er war zu klein und mit einem deutlichen Doppelkinn versehen. Ich mochte weder meine Nase noch meine Ohren, denn sie wirkten zu groß für mein kleines Gesicht. Meine Haut nahm überhaupt keine Sonne an und wirkte besonders im Sommer immer kränklich. Dafür hatte ich noch kein einziges Fältchen – weder im Gesicht noch am Hals, nicht einmal an den Händen. Insgesamt sah ich fünf bis zehn Jahre jünger aus, worum mich fast alle anderen Frauen beneideten. Mich hingegen störte es, denn es kam mir so vor, als unterschied ich mich zu wenig von meinen Studentinnen.
Zu meiner wiederkehrenden Verwunderung standen nicht wenige Männer auf mich – jüngere ebenso wie ältere. Nur die Männer meines Alters übersahen mich, als trüge ich eine Tarnkappe, was mich kränkte und verunsicherte. Die Jüngeren ließen mich in Ruhe und verehrten mich eher aus der Ferne, aber die Älteren warben offensiv um mich. Ich wusste nicht, was ihnen an mir gefiel, und sie sagten es mir auch nicht. Ich nahm an, ich sei eben der Typ Frau, dem Männer keine Komplimente machten. In den fünf Jahren als Assistenzprofessorin bekam ich mehr Anträge als in allen anderen Lebensphasen zusammen. Ich versuchte alles, um meine innere Kälte zu verscheuchen. Ich bemühte mich darum, von einem Mann geküsst zu werden. Aber unter der Straßenlaterne vor dem angesagtesten Restaurant des Städtchens blieb mein jeweiliger Begleiter mit hängenden Armen und einem schiefen Lächeln vor mir stehen und wusste nicht, ob er sich verabschieden oder mich nach Hause begleiten sollte.
So unbefriedigend sich auch mein Privat- und Gefühlsleben entwickelte, so erfolgreich war hingegen mein berufliches Fortkommen. Nach fünf Jahren schloss ich das i-Phone-Projekt und die Niederschrift meiner Thesen und Erkenntnisse ab. Im April 2012, wenige Tage nach meinem siebenunddreißigsten Geburtstag erhielt ich die Habilitation, den Titel einer Professorin und eine halbe Stelle als Privatdozentin an unserer Fakultät. Ein Jahr später veröffentlichte ich ein populäres Sachbuch: Bin mit Heinz – aber mega. Die Sprache der sms-Kurznachrichten.
Читать дальше