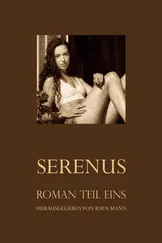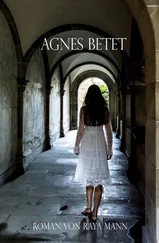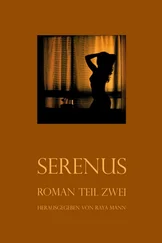Am Silvesterabend gaben die Angestellten der Abteilung für Deutsche Sprachwissenschaft ein Willkommensfest für mich. Die meisten waren mir irgendwann schon einmal vorgestellt worden, aber nun lernte ich auch ihre Ehe– oder Lebenspartner kennen. Während der Party fiel es mir gar nicht auf, sondern erst am anderen Tag, als ich versuchte, mich an alle Gesichter zu erinnern. Unter lauter Paaren war ich die einzige Person ohne Begleitung gewesen.
❖
Ein neues Leben anzufangen ging schneller und einfacher, als ich erwartet hatte. Das Absterben des vorherigen Lebens hingegen setzte erst nach einiger Zeit und überaus zögerlich ein. Genau genommen lebte es weiter und alterte bloß dahin, wie ein mächtiger kranker Baum, der immer wieder austreibt und sich nicht um den Sturm schert, der ihm jeweils im Herbst einen weiteren Zacken seiner Krone raubt. Es waren die massigsten Äste, die abbrachen, die langjährigsten Freundschaften, die morsch wurden und zersplitterten. Dagegen wehrte ich mich und es dauerte lange, bis mich damit abfand.
Gastfreundschaft war mein Credo. Nicht zuletzt deswegen hatte ich das schmucke Jahrhundertwendehaus ausgesucht. Zwei Paare oder eine Familie mit Kindern konnte ich bequem darin unterbringen, ohne dass es eng wurde. Das Städtchen eignete sich zum Flanieren und Verweilen. Mit dem Auto war man schnell in Bern, Thun, Neuchâtel oder Montreux. Im Westen lag das Tiefland mit den drei Seen, im Süden die Hochebene von Greyerz, im Osten das Gebirge mit seinen Wanderwegen und Skipisten, im Norden die Hügel, Täler und Flüsse. Die Vergangenheit war allgegenwärtig: Römer und Ritter, Reformation und Renaissance, Religionskriege und Revolutionen, Romantik und Realismus.
Der halben Welt schrieb ich Mails mit Fotos vom Haus, vom Städtchen und von meinen Ausflügen in alle vier Himmelsrichtungen. Jeden, den ich irgendwie kannte, lud ich ein. Fast alle kamen auch und besuchten mich, einige für ein Wochenende oder über die Feiertage, andere für eine Woche oder länger. Während der drei Jahre beherbergte ich Gäste, als führte ich eine kleine Pension. Manche kamen zweimal oder dreimal. Als der Zustrom versiegte und es still wurde im Haus, wollte ich es lange Zeit nicht wahrhaben. Im Frühjahr 2010, als ich meine Habilitationsschrift fertig stellte und meinen 35. Geburtstag feierte, lud ich alle Menschen aus meinem alten Leben noch einmal ein. Aber die wichtigsten waren verhindert oder fanden eine gute Ausrede. Als die kleine Gästeschar in der Glasveranda beisammen war, stellte ich verblüfft fest, dass nur die Männer gekommen waren. Die „Mädels“ hatten mir einen Korb gegeben oder in letzter Minute abgesagt. Der kranke Baum meines alten Lebens hatte seine letzten Blüten getragen und setzte keine Früchte mehr an.
Von meiner Familie hatte mich niemand besucht. Ich war Waise und hatte mich seit Jahren nicht mehr um die Geschwister meiner Eltern gekümmert. Falls überhaupt noch Tanten oder Onkel lebten, dann wären sie fast so alt wie das Haus, in dem ich wohnte. Mein ältester Bruder, lebte inzwischen in Deutschland, in einem der neuen Bundesländer, wo er ein politisches Amt innehatte und seine Prominenz auskostete. Wir waren jedoch nicht zusammen aufgewachsen, denn als ich geboren wurde, war er bereits ausgezogen. Wir hatten weder gemeinsame Erinnerungen noch aktuelle Berührungspunkte. Von meinem anderen Bruder, der immer als „der Mittlere“ bezeichnet wurde, wollte ich nichts mehr wissen und er ebenso wenig von mir. Es blieb mir immerhin meine Kusine Eva erhalten, die Lieblingsnichte meines Vaters. Wir waren gleichaltrig, langjährige Freundinnen und uns in den letzten Jahren noch nähergekommen. Sie hatte sich auf den ersten Blick in mein neues Haus und das Städtchen verliebt. Von da an kam Eva, wann immer sie sich freimachen konnte, zu mir in die Schweiz. Je älter wir wurden, desto enger wurde unsere Freundschaft.
In der Abteilung für Deutsche Sprachwissenschaft fand ich die Art und das Maß von Geborgenheit, die ich für mein inneres Gleichgewicht benötigte. Die Universität war in der ganzen Schweiz berühmt dafür, überschaubar und familiär zu sein. An keiner anderen Hochschule kamen so viele Lehrkräfte auf so wenige Studenten. Schon damals, als ich hier die Ausbildung machte und mich auf das Lizentiat vorbereitete, lernte ich das Engagement meiner Lehrer zu schätzen. Wir wurden nicht nur behutsam, sondern auch kompromisslos angetrieben, so dass sich unser Ehrgeiz mit demjenigen unserer Professoren verband. Die gegenseitige Wertschätzung war so groß, dass echte Bindungen zwischen ihnen und uns entstanden. Selbst nachdem ich die Uni verlassen hatte, wachte meine Ordinaria über meine weitere Laufbahn und überredete mich sechs Jahre später dazu, mich an ihrem Lehrstuhl zu bewerben. Meine Assistenzprofessur stand nicht auf dem Sollstellenplan, sondern wurde mit Mitteln aus einem länderübergreifenden Förderprogramm der eu finanziert. Irgendwann wurde mir zugetragen, dass meine Berufung von Anfang an ein abgekartetes Spiel gewesen sei.
So klein sie auch war, so handelte es sich doch um eine richtige Universität mit allen traditionellen und modernen Fächern. Neben den Fakultäten für Theologie, Recht, Wirtschaft, Philosophie, Sprachen, Geschichte, Medizin und Naturwissenschaften existierten auch Studiengänge in Musik, Sportwissenschaft, Kommunikation, Sozialwissenschaften, Didaktik und Mehrsprachigkeit. Es gab mehr als ein Dutzend sprachliche Abteilungen, zwei davon für Germanistik, denn deutsche Literaturwissenschaft und deutsche Sprachwissenschaft waren streng voneinander getrennt. Letztere war eine der kleinsten Abteilungen an der ganzen Uni.
Ich selber unterrichtete die Studenten des dritten und vierten Semesters in Grundlagen der linguistischen Forschung. Mein Seminar gehörte zu den Pflichtveranstaltungen für Hauptfachstudenten, deren Zahl sich an zwei Händen abzählen ließ. Mit diesem intimen Grüppchen arbeitete ich an dem Projekt, mit dem ich mich habilitieren sollte. Meine Forschung befasste sich mit Kurznachrichten, also mit den über Mobiltelefone ausgetauschten sms. Die Abteilung stellte meinen Studenten ein Handy zur Verfügung und zwar das begehrte i-Phone, das Apple in jenem Jahr neu auf den Markt brachte. Die Geräte waren so programmiert, dass jedes versendete sms auf unserem Server abgespeichert wurde. Natürlich mussten die Teilnehmer eine Schweigepflichterklärung unterschreiben, denn das Seminar fand buchstäblich in ihrer Intimsphäre statt.
Das i-Phone-Projekt, wie es bald von allen genannt wurde, machte von sich reden. Es bekam einen elitären Nimbus und ich setzte meine ganze Autorität daran, meinen zehn Studenten einen gewissen Dünkel auszureden, vielmehr, ihn gar nicht erst aufkeimen zu lassen. Ich machte ihnen begreiflich, dass Ehrgeiz und Demut zwei Seiten derselben Medaille seien. Als ich den Teilnehmern so ins Gewissen redete, ahnte niemand von uns, dass sich die Bescheidenheit bald von selber einstellen würde. Denn unser i-Phone-Projekt erwies sich schon nach kurzer Zeit als tierische Plackerei. In den ersten zwei Semestern sammelten wir eine halbe Million sms auf dem Server, sodass wir das Vorhaben von Grund auf neu überdenken mussten.
Die Uni gab mir fünf Jahre, um das Forschungsprojekt und meine Habilitation abzuschließen, denn die europäischen Fördermittel waren für diesen Zeitraum zugesprochen worden. Ich vergeudete viel zu viel Zeit, um dem Unterfangen eine Richtung zu geben und es in Fahrt zu bringen. Das Ganze war ehrlich gesagt ein paar Nummern zu groß für mich, zumal ich damals fast ununterbrochen Gäste zu Besuch hatte. Ich ging ja erst auf Mitte Dreißig zu, was aber mindestens ein Gutes hatte – nämlich meine schier unerschöpfliche Energie. Ohne diese Reserven hätte ich mich verausgabt. Als ich das i-Phone-Projekt pünktlich zum Ende des Jahres 2011 abschloss, musste ich mir eingestehen, dass ich eine solche Ausdauer künftig nicht nochmals würde aufbringen können. Aber das würde bestimmt nie wieder notwendig sein.
Читать дальше