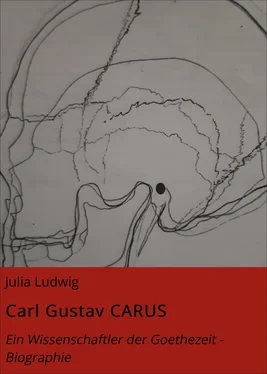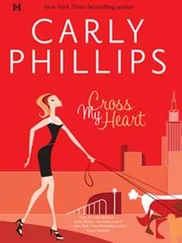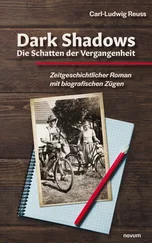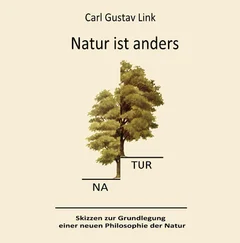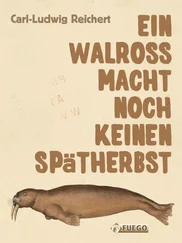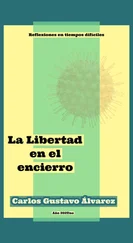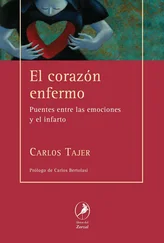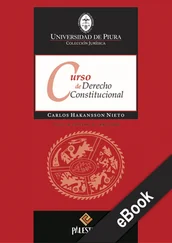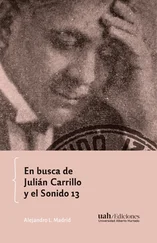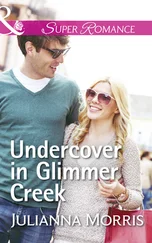Deutlich wird jedoch seine Kritik an Napoleon in seiner Biographie, indem er dessen Regierung als despotisch bezeichnet.38
Immer wieder wurde Sachsen Austragungsort der Kämpfe um Monarchie beziehungsweise Demokratie. Im Jahr 1812, als der Kaiser in Dresden weilte, die Monarchen Österreichs und Preußens empfing und sich die Heere der Länder „in den ungeheuersten Massen [versammelten, wurde] die Spannung, welche dieses alles auch in unserer Stadt hervorbrachte, […] eine noch nie da gewesene.“39
1813 erschien für Carus der günstigste Augenblick den französischen Despotismus bezwingen zu können. „Überall regte es sich in Schrift und Rede und Gesang, damit das Volk erwachen und seine Ketten abschütteln möge […] und eine mächtige Begeisterung machte sich fühlbar durch das ganze Land.“40 Einen beträchtlichen Anteil an Verweigerung gegenüber Frankreich schrieb Carus Literaten zu. Insbesondere Friedrich Schiller, auch wenn dieser bereits 1805 verstorben war, soll mit „Don Carlos“ und „Wilhelm Tell“ einen „Freiheitsgedanken“41 verbreitet haben.
In diesem Jahr schienen die Veränderungen und die herannahenden Auseinandersetzungen eine andere Dimension erreicht zu haben – eventuell, da offensichtlich das ganze Volk bereit war sich gegen die Monarchie zur Wehr zu setzen, und die Schlachten somit nicht nur auf Heeresseite stattgefunden haben können, so dass Carus seine Frau zu Verwandten in die Stadt brachte, da die Vorstadt, in der sie lebten, leicht hätte eingenommen werden können.42
Zudem war es diesmal notwendig, dass Carus als Mediziner, obwohl er bis dato lediglich theoretisch die Versorgung von Wunden nahe gebracht bekommen hatte, tätig wurde. Tausende Verwundete galt es zu verarzten und an den 24-jährigen wurde die Frage gerichtet, ob er gewillt sei, die Leitung eines Französischen Militärspitals zu übernehmen. Carus bisheriges Leben, das Studieren der Natur, der Kunst und der Wissenschaften wurde durch die Auseinandersetzungen gestört.
„An ernste Wissenschaftsarbeiten war in dieser Zeit so nicht zu denken, ich las kein Kollegium diesen Sommer, meine Familie bedurfte der Unterstützung; der Gefahr der Ansteckung [durch Krankheiten der Soldaten], der jetzt so manche Ärzte unterlegen waren, setzte ich Mut und ein höheres Vertrauen entgegen […].“43
Im Herbst 1813 musste Carus eine weitere bittere Erfahrung in diesem Krieg erleben: Das Spital, in welchem er tätig war, sollte von ihm geräumt werden und wurde später von den eigenen Soldaten in Brand gesteckt, damit es schwedischen Gegnern nicht nützlich werden konnte.
Politisch äußert sich Carus sehr spärlich. Lediglich die napoleonische Diktator kritisiert er beiläufig. Wie wenig Position er bezog wird nicht nur darin ersichtlich, dass das Universalgenie, welches Carus war und welches über vielerlei Themen schrieb, nicht über die politische Lage Deutschlands oder über Napoleon schrieb, sondern auch darin, dass Carus ein Französisches Lazarett führte und zugleich einen preußischen Offizier in seinem Garten verpflegte. Zugespitzt dürfte sich die Situation haben, als das Haus der Familie von preußischen Soldaten besetzt worden war, während im Hof und in der Färberei Kosaken verweilten.44
Dass die Französische Revolution und deren Folgen für Deutschland und Carl Gustav Carus prägend waren, bleibt außer Frage. Erstaunlich ist jedoch, dass sich keinerlei Todesfurcht in seinen geradezu oberflächlichen Gefühlsbeschreibungen finden lassen. Einzig die Beschreibung der Machtlosigkeit ist dem Leser gegeben:
„Alles Hergebrachte, in gewisser Regelmäßigkeit durch Gewohnheit Geheiligte ist aufgehoben, nur dem Drange
des Augenblicks, nur der eben jetzt gebieterisch geforderten Notwendigkeit wird gehorcht, und doch, auch, so lebt man weiter und sieht fast mit Erstaunen, dass der Tag vorübergegangen ist, den man kurz zuvor fast unübersteigbar wähnte.“45
2.4.2 Erkrankung an Typhus
Nach dem 22. Oktober 1813, am Tag nach dem Brand des Spitals, besuchte der Arzt des Öfteren diese Stätte. Es fehlte dort, so seine Aussage an jeglicher Aufsicht und Organisation.
Von dem Bild des dortigen Zustandes „im tiefsten ergriffen“46 besorgte er für die Überlebenden Nahrung und Arznei. Einige Tage der Hilfe vergingen, bis Carus an Typhus erkrankte. Drei Wochen seines Lebens seien, so Carus, durch diese Bakterienübertragung ohne jedwede Erinnerung im Fieberwahn vergangen.
Lediglich einige Fantasmen, wie den Gewinn in einer Lotterie, mit dem er den 1808 in Königsberg gegründeten Tugendbund47 finanziell unterstützen und somit das Land retten wollte, blieben Carus in Erinnerung.
Sein Zustand war durchaus kritisch. Sein einstiger Leipziger Professor und nunmehr Kollege Johann Clarus vertrat die Ansicht, der Patient sei nicht mehr zu retten. Wie lange die Krankheit insgesamt andauerte wird nicht genau gesagt. Durch eine, für ihn wissenschaftliche Rekapitulation der Krankheit beschreibt er deren weiteren Verlauf.
Erläutert wird, wie das Unbewusste in seiner Psyche nach einem Bad drängte. „Ein prophetisches Gefühl machte sich geltend, und es erwachte plötzlich in mir eine unwiderstehliche Sehnsucht nach einem Bade.“48
Während dieser Reinigung soll der Kranke lichte Momente gehabt haben. Er konnte sich an diese Situation erinnern, auch wenn er verwirrt war: Er glaubte, sein Haus wäre vom Feuer zerstört worden – eine geistige Übertragung der Begebenheiten des Spitals schien auf seine privaten Domizile stattgefunden zu haben.
Während diesen Bades fühlte er sich so wohl, dass er, so die Erzählungen seiner Familienangehörigen, aus Goethes Fischerlied zitierte: „O wüsstest du, wie’s Fischlein ist/So wohlig auf dem Grund.“49
Ein Wendepunkt schien im Verlauf der Krankheit erzielt worden zu sein, doch eine Wiederholung desselbigen, die der Kranke selbst nicht wünschte, griff ihn entgegen den Erwartungen Anderer an und schwächte ihn.
Von der Krankheit sich langsam erholend musste Carus erneut Laufen lernen, da sein Körper kraftlos war. Und auch politisch hatte sich einiges ereignet, von dem der Genesene während seiner Bettlegrigkeit nichts bemerkt hatte.
„Wie sonderbar war mir jetzt, als ich anfing, von den Dingen um mich her wieder Kunde zu nehmen! Die Weltgeschichte hatte eine andere Gestalt angenommen, die fränkische Herrschaft war zertrümmert, Deutschland war frei, und die Verbündeten waren auf dem Wege nach jenem Paris, von wo aus lange Europa Gesetze diktiert worden waren!“50
Carus versteht diese Zeit der Krankheit aufgrund des Fieberwahns, der Veränderungen im Land und den vielen Opfern des Typhus, durch die ganze Familien zerrissen worden waren, als „eine wahrhafte Wiedergeburt“.51 Er konnte körperliche sowie geistige Erfahrungen sammeln und erfuhr die Unterstützung von Familie und Freunden.
Im November 1814 wurde dem Gynäkologen das Angebot unterbreitet, das Entbindungsinstitut Dresdens zu leiten. Carus selbst sagt über diese Tätigkeit, dass er anfangs nicht geglaubt hätte, wie groß die Aufgabe dieser Krankenhausleitung werden würde. Es wurde ihm eine freie Wohnung, die für die Familie recht klein bemessen war, innerhalb desselben Hauses angeboten und 500 Taler ausgesetzt, die Carus nicht genug erschienen.
Trotz allem nahm er diese Stelle an und sprach in den fortlaufenden Jahren von einer entscheidenden Veränderung in seinem Leben.
Hierbei wird wohl auch der Abschied von Leipzig und dessen PatientInnen Carus Eindrücke bereichert haben. In seiner Autobiographie berichtet er, wie er sich von diesen, für die er als Armenarzt tätig war, verabschiedete.
„Gerade in diesem Verhältnis aber, wo der Arzt ganz frei und unendgeldlich Kranken und Bedrängten zur Seite steht, in diesem Verhältnis, wo er zugleich durch Verordnung von Nahrung und Holz zum Wohltäter so vieler werden kann, ist dem, der mit Milde und echter Teilnahme seine Aufgabe behandelt, eine gar schöne und im edelsten Sinne humane Stellung gegönnt.“52
Читать дальше