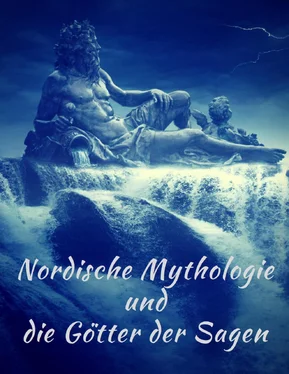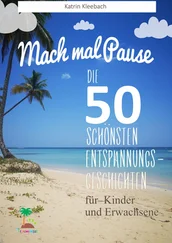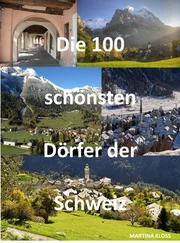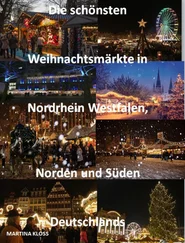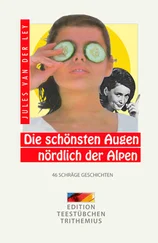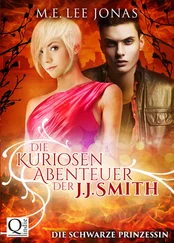Wann bricht dieser herein? Wann ist die Stunde der Götterdämmerung gekommen? Diese bange Frage beschäftigt unablässig den obersten der Götter, Odin, »den grübelnden Asen«. Düstere Ahnungen, böse Träume ängstigen ihn und Baldur. Der mannigfaltigen Rat suchende unerschrockene Götterkönig forscht bei allerlei Wesen nach dem, was sie etwa hierüber wissen mögen; selbst zur furchtbaren Behausung Hels und zu den Nornen steigt er, Zukunft forschend, hinab. Mit geringer Ausbeute kehrt er zurück! Erst das Ende der Dinge selbst, das unvermeidbare, gibt die Antwort auf die Frage; – und erst am Ende der hier zu schildernden Geschehnisse, nachdem die Götter, ihre Helfer, ihre Schützlinge und ihre Feinde sich vor unsern Augen ausgelebt haben, können auch wir die Antwort finden auf jene Frage.
Zweites Kapitel. Die einzelnen Götter. Elben, Zwerge, Riesen. Andere Mittelwesen.
I. Odin-Wotan.
Odin führt uns in die höchsten und tiefsten, die feinsten und meist durchgeistigten Elemente des germanischen Wesens. Thor-Donar ist der Gott der Bauern, Odin-Wotan, der Siegeskönig, ist der Gott der völkerleitenden Fürsten und Helden; zugleich aber (und das ist das Wunderbare, in dieser Vereinung so ganz für die germanische Volkseigenart Bezeichnende) ist er der Gott der Weltweisheit und der Dichtung; die grossen Könige der Völkerwanderung und die Kaiser des Mittelalters wie anderseits der ewig suchende Faust der deutschen Weltweisheit: Kant, Fichte, Hegel, Schelling, aber ebenso die grössten germanischen Dichter: Shakespeare, Goethe und der Dichterphilosoph Schiller; – alle diese Männer hätten unter dem Asenglauben Odin als ihren besondern Schutzgott betrachtet; alle diese unter sich so grundverschiedenen und doch gleichmässig für germanisches Eigenwesen so scharf bezeichnenden Gestalten, – sie sind Erscheinungen dessen, was die heidnische Vorzeit unsres Volks in ihren obersten Gott gelegt hat; ahnungsvoll hat das Germanentum in die eigne Brust gegriffen und seine höchste Herrlichkeit in Staats- und Siegeskunst, seine Heldenschaft, seine tiefste Tiefe in grübelnder Forschung, seine sehnsuchtsvollste dichterische Begeisterung verkörpert in seinem geheimnisvollen Götterkönig; es weht uns an wie Schauer aus den Urtiefen unsres Volks, gehen wir daran, Odins Runen zu deuten und die Falten zu lüften seines dunkelblauen Mantels. –
Woher rührt jene Verbindung scheinbar unvereinbarer Elemente in einer Göttergestalt?
Die Ursache liegt zum Teil in der Naturgrundlage, zum Teil in der Stellung Odins als obersten Königs und Leiters der Walhallgötter.
Seine Naturgrundlage ist die Luft, – die alldurchdringende; von diesem Alldurchdringen führt er ja auch den Namen; wir Neuhochdeutschen freilich brauchen »waten«, »durchwaten« nur mehr von dem Durchschreiten des Wassers, höchstens etwa noch einer dichten Wiese oder einer Sandfläche; aber althochdeutsch watan, altnordisch vadha, bedeutete jedes Durchschreiten und Durchdringen; die Luft aber, in allen ihren Formen und Erscheinungen gedacht, welche Fülle von Gegensätzen schliesst sie ein! Von dem lautlosen und regungslosen blauen Äther, von dem gelinden, geheimnisvollen Säuseln der Frühlingsnacht, das kaum das junge Blatt der Birke zittern macht, bis zum furchtbar brausenden Sturmwind, der im Walde die stärksten Eichenstämme knickt; – alle diese Erscheinungen nun sind Erscheinungen Wotans; – er ist im gelinden Säuseln und nicht minder im tosenden Sturm. Aber durch diese seine Luftnatur wurde Wotan noch mehr; – er wurde zum Gott des Geistes überhaupt. In mehreren Sprachen ist das Wort für den leisen, unsichtbaren, doch geheimnisvoll allüberall fühlbaren Hauch der Luft eins mit dem Wort für Geist.
Wotan, der Gott des Lufthauchs, ist also auch der Gott des Geisteshauchs; und zwar des Geistes in seinem geheimnisvollen Grübeln, in seiner tiefsten Versenkung in die Rätselrunen des eignen Wesens, der Welt und des Schicksals; wer der Natur und der Geschichte ihre Rätsel abfragen, wer die Ursprünge und die Ausgänge aller Dinge ergründen, wer Gott und die Welt im tiefsten Wesenskern erforschen, d. h. wer philosophieren will, der tut wie Odin; Odin, der »grübelnde Ase«, wie ihn bezeichnend die Edda nennt. Ahnungsvoll hat der deutsche Geist den ihm eignen philosophischen Sinn und Drang, der ihn vor allen Nationen kennzeichnet, seinen Faustischen Zug, in das Bild seines obersten Gottes gelegt. Wie der Wahrheit suchende Grübler Faust nicht harmlos der frohen Gegenwart geniessen mag und sich des Augenblicks und der hellen Oberfläche der Dinge erfreuen, wie es ihn unablässig drängt, den dunkeln Grund der Erscheinungen zu erforschen, die Anfänge, die Gesetze, die Ziele und Ausgänge der Welt; – so der »grübelnde Ase«. Während die andern Götter sich den Freuden Walhalls hingeben oder in Abenteuer, in Kampf und Liebe der Gegenwart leben, uneingedenk der Vergangenheit und um die Zukunft unbesorgt, kann Odin nun und nimmer rasten im Suchen nach geheimer Weisheit, im Erforschen des Werdens und des Endschicksals der Götter und aller Wesen. Die Riesen oder einzelne unter ihnen gelten als im Besitz uralter Weisheit stehend; Odin ermüdet nicht, solche weisen Meister aufzusuchen und auszuforschen; hat er doch sein eines Auge selbst als Pfand dahingegeben, um von dem kundigen Riesen Mimir Weisheitslehren zu empfangen; denn im Wasser, in »Mimirs Brunnen«, liegen die Urbilder aller Dinge verborgen; er versenkt deshalb sein Auge in diesen Brunnen. Zauberinnen, weissagende Frauen, lebende und tote, forscht er aus; ja er hat die »Runen«, den Inbegriff aller geheimen Weisheit, selbst erfunden. Auch mit kundigen Menschen hält er Wettgespräche der Weisheit, in welchen der Götter und aller Wesen Entstehung, Wohnung, Sprache, Schicksal und Ende erörtert wird. So hat er denn auch die Geheimkunde von der unabwendbar drohenden Götterdämmerung ergrübelt; – aber zugleich auch das trostreiche Hoffnungswort von der Erneuerung, von dem Auftauchen einer neuen, schönen, schuldlosen Welt; und er vermag dies Trostwort als letztes Geheimnis seiner Weisheit dem toten Lieblingssohne Baldur noch in das Ohr zu raunen.
Es sind zunächst äussere Gründe, welche den Leiter der Walhall-Götter zu solcher Forschung führen; – das Bedürfnis, die den Göttern von den Riesen drohende Gefahr der Zukunft zu erkunden –; aber ebenso unverkennbar hat die Edda, hierauf weiterbauend, dem »grübelnden Asen« den tief germanischen Drang nach Weltweisheit eingehaucht. Unablässig forscht der Gott, der nicht allwissendist, aber es sein möchte; täglich sendet er seine beiden Raben aus, die Welt und den Lauf der Zeiten zu erkunden; zurückgekehrt sitzen sie dann auf seinen beiden Schultern den flüstern ihm geheim ins Ohr; sie heissen aber – denn nicht könnten die Namen bezeichnender sein – sie heissen »Hugin« und »Mugin«: »Gedanke« und »Erinnerung«.
Vom Geist untrennbar ist die Durchdringung mit Geist, die Begeisterung; und wie der philosophische, findet der dichterische Drang germanischen Volkstums, der Geist, der, vom Trank der Schönheit trunken, selbst das Schöne zeugt, in Odin seinen Ausdruck. Zwar hat die nordische Mythologie einen besondern Gott des Gesanges aufgestellt, Bragi (Odins Sohn), »der die Skalden ihre Kunst gelehrt« (s. unten); aber er ist nur eine Wiederholung, eine einzelne Seite Odins; Odin ist der Gott höchster dichterischer Begeisterung, jener Entzückung künstlerischen Schaffens, welche, -auch nach Sokrates-Platon, mit der wärmsten Liebesbegeisterung für das Schöne verwandt, auch von andern Völkern als ein Rausch, als eine Art göttlichen Wahnsinns gefasst und gefeiert wird. Tief hat es das germanische Bewusstsein erfasst, dass nur aus der Liebe höchsten Wonnen und Qualen der Trank geschöpft wird unsterblicher Dichtung.
Der Trank oder Met der Dichtung war entstanden aus dem Blut eines Zwergen Kwâsir, »der war so weise, niemand mochte ihn um ein Ding fragen – er wusste Antwort«. Den Trank hatte in Verwahrung des Riesen Suttung schöne Tochter Gunnlöd; unter falschem Namen, durch List und in Verkleidung gelangt Odin zu ihr; er gewinnt die Liebe der Jungfrau; drei Tage und drei Nächte erfreut er sich ihrer vollen Gunst und die Liebende gestattet ihm, drei Züge von dem Trank zu schlürfen; aber in diesen drei Zügen trinkt der Gott die drei Gefässe leer, nimmt Adlersgestalt an und entflieht nach Walhall, indem er für sich und seine Lieblinge, denen er davon verleihen mag, die Gabe der Dichtung unentreissbar gewonnen hat; sie heisst daher »Odins Fang«, »Odins Trank«, »Odins Gabe«.
Читать дальше