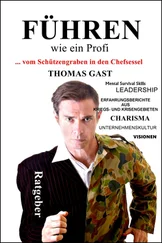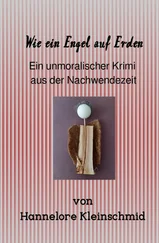Wieder schaute Grünbaum Cornelius nur vielsagend an, fuhr dann aber fort:
»Dann wurde uns vor Jahrzehnten nach den Goldgräbern eine neue Welle von Einwanderern aus aller Herren Länder beschert, die zu Hause wahrscheinlich auch nicht weiter kamen. Sie hatten sich in der Hölle von Panama für den Eisenbahnbau verdingt. Die kolossale Arbeit und Krankheiten, vor allem das Gelbfieber und die Malaria rafften bis zur Fertigstellung die meisten hinweg. Der Rest blieb im Land hängen. Dann wurde vor einigen Jahren von den Franzosen der Kanalbau begonnen, wieder mit vielen zehn-tausend Arbeitern aus aller Herren Länder, meist angelockt als Ungelernte. Die Fehlkonstruktion war ein komplettes Desaster, an dem das Land heute noch leidet. Überall ist die Erde aufgewühlt, wo Wasser fließen sollte. Die Arbeiter starben wie die Fliegen, eilig verscharrt auf riesigen Friedhöfen, getötet durch die Dämpfe, seit neuestem sagt man auch von den Milliarden von Mücken aus den Sümpfen. Die Ingenieure haben das Land schon längst wieder verlassen. Die restlichen Überlebenden kommen nun zu den anderen und lungern in den Städten und Dörfern herum.«
»Eigentlich sollte es der Landbevölkerung besser gehen seit der Befreiung von und dem Zerfall der spanischen Kolonialmacht. Die Einheimischen haben Land bekommen, wenn auch nicht viel, aber sie können oder wollen damit nicht wirtschaften. Selbst hundert Kaffeesträucher würden genügen, um mit der Ernte der Kaffeebohnen einen entscheidenden Anfang zu machen. Dazu braucht man wirklich nicht viel Kapital, und das würden wir sogar vorstrecken, wenn wir wüssten, dass wir dafür eines Tages auch die Ernte aufkaufen könnten. Meine eigene Philosophie ist, dass das Leben auf Gegenseitigkeit beruhen sollte. Aber jeder muss dabei seiner Verpflichtung nachkommen. Heute zieht das Landvolk in der Erwartung auf ein besseres Leben in die Städte, wenn es ihnen in ihren Hütten zu eng und schwierig wird. Aber Sie haben ja selbst gesehen, wie heikel sie es in der Stadt haben. Die Politik wird immer noch von der alten Kolonialkaste gesteuert, ist zutiefst korrupt, lebt in einer Klüngelwirtschaft und kümmert sich nur um die eigenen Vorteile. Die Kirche - verzeiht Hochwürden - hält sich aus all dem heraus und hofft auf bessere Zeiten. Die Geschäftswelt gehört uns Deutschstämmigen zusammen mit den Amerikanern und Engländern. Die alten spanischen Familien haben immer noch ihre Haziendas, wie seit eh und je. Sie bauen in erster Linie Kaffee und Zuckerrohr an und verkaufen die Erzeugnisse an uns zum Export nach Übersee. Das sind beinahe die einzigen erwähnenswerten Einnahmen, die das Land erwirtschaftet, außer dem Geld, das die Passagiere zurücklassen, wenn sie den Isthmus überqueren. Dabei gehört die Eisenbahn auch nicht dem Staat von Panama, sondern den Amerikanern.«
»Wir Deutschen haben einen wichtigen Anteil am Kaffeehandel in Händen. Natürlich war das nicht immer so. Nehmen Sie meine Familie. Mein Großvater landete hier in Panama, er hatte Fortune, aber auch Grips genug sich umzusehen, was der Landstrich ihm bieten könnte. Er war sozusagen gestrandet auf dem Weg nach Kalifornien, zu erschöpft vom harten Fußmarsch den Isthmus zu überqueren. Damals gab es ja noch keine Eisenbahn. Den Proviant hatte er auf dem langen Marsch aufgefuttert, der eigentlich bis Kalifornien hätte reichen sollen und die Ausrüstung für das Goldschürfen war verloren gegangen oder er hatte alles weggeworfen, weil das Werkzeug in der Hitze und Schwüle zu schwer geworden war. Im Nachhinein war das ein Glück für unsere Familie, wie auch für so manch anderen Gefährten, der sich für das Gleiche entschied. Wir haben es in diesem Land geschafft, wir sind nicht dem Geldrausch zu verfallen, noch sind wir in Kalifornien dem Goldrausch verfallen und verkommen. Zugegeben, unsere Vorfahren waren anfänglich Glücksritter, aber letztendlich doch ein klein bisschen cleverer oder realistischer als viele andere. Sie können es auch Chuzpe nennen oder Schicksal, auf alle Fälle scheint der Allmächtige uns bis jetzt in Händen gehalten zu haben.«
Während sie sich noch unterhielten, hatte sich die Landschaft rasch verändert. Links und rechts des Weges breiteten sich nun weite, zur Ernte bereite Zuckerrohrfelder aus abwechselnd mit frisch gepflügtem Land aus rostroter Erde und mit neu gepflanzten Parzellen. Ihr Zweispänner wurde beinahe auf der schmalen Straße, wie in einer hohlen Gasse, von dem Blätterwald des mehrere Meter hohen Zuckerrohrs eingeschlossen. Nach einer Wegbiegung schien sich plötzlich vor ihnen der Tunnel in einem dichten Nebel aufzulösen. Es roch intensiv nach Verbranntem, und man sah durch die Schwaden links am Weg vom Boden her gelb-rotes Feuer züngeln. Die Pferde scheuten und waren kaum zu beruhigen. Zum Glück wusste der Kutscher damit umzugehen, es sah schlimmer aus, als es tatsächlich war. Er hatte das nicht zum ersten Mal erlebt, stieg ab und führte das Gespann durch die Rauchwand. Feuer und Qualm waren durch das Abbrennen des erntereifen Zuckerrohrs entstanden. Alle Blätter und die Blütenstände wurden abgefackelt, weil sie kaum Zuckersaft enthielten und die Arbeit und den Transport nur noch zusätzlich erschwerten. Das zuckerhaltige Rohr ragte als schwarz verkohlte Stecken aus der grau-braunen, immer noch rauchenden Asche, als wertvoller Dünger für den nährstoffarmen Tropenboden. In einem benachbarten Feld, das wahrscheinlich schon vor ein paar Tagen abgezündelt worden war, schwangen die Arbeiter schwere Macheten und schnitten die bis zu armdicken Stängel kurz über dem Boden ab. Andere trugen sie in großen Haufen zusammen, die dann in knochenharter Arbeit auf Ochsenkarren mit hohen Seitengattern aufgetürmt wurden. Die Hitze war mörderisch, das Feld flimmerte, die Arbeiter ächzten unter der Schwere der Bündel. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Keiner redete, denn jedes unnötige Wort wurde zur weiteren Bürde. Die wenigen Lumpen, die sie anhatten, hingen nass vor Schweiß an ihren ausgemergelten, sonnenversengten Körpern. Schon der Anblick verursachte Pein. Einzig die Ochsen, immer vier nebeneinander vor die Karren gespannt, warteten, Zuckerrohrabfälle wiederkäuend, in stoischem Gleichmut auf den Befehl zum Anziehen
Der Kutscher war wieder aufgesessen, die Pferde hatten sich inzwischen beruhigt und trotteten gemächlich auf eine vor ihnen liegende grüne Baumoase zu, die sich in eine fantastisch blau blühende Jacaranda-Allee öffnete. Am Ende lag der noble Landsitz, die Gebäude der Rodriguez Hazienda, umgeben von hochragenden Bäumen mit gewaltigen Schirmkronen, die wohltuende Schattenkühle spendeten.
Beide Stockwerke des gepflegten Anwesens umrundeten breite Veranden, die von holzverzierten Säulen getragen wurden und durch filigrane Bogen miteinander verbunden waren. Die zurückgebauten Zimmer lagen in angenehmem Schatten. Die weiträumige Residenz versprach Rast, aber auch Mahlzeit. Der Hausherr stand bereits wartend auf dem schattigen Patio, so als beschäftigte er ein Netz von Kundschaftern, um ihm die Ankunft aller Besucher, erbetene oder unerbetene, auf seiner Latifundie rechtzeitig kund zu tun. Schaukelstühle, Korbsessel und kleine und große Tische standen überall verteilt, dazwischen lagen, wie zufällig, drei große, schwarze Hunde, die gemächlich mit ihren dünnen Schweifen zum Gruß der Ankömmlinge die Holzdielen behämmerten. Sie hatten sich nicht erhoben, ihre Augen folgten aber aufmerksam allen Bewegungen der Gäste und den Gesten ihres Herrn. Man sollte ihre gespielte Trägheit nicht unterschätzen!
»Fernando, mein geschätzter Freund, dürfen wir eintreten?« begrüßte ihn Herr Grünbaum mit ausgestreckten Händen. Man umarmte sich, klopfte sich auf die Schultern, links, dann rechts, dann nochmals links, wobei die beiden Männer die Wangen aneinander drückten. Ja, man hatte auf der Farm nicht zu häufig Gäste und Señor Rodriguez war keiner von der Sorte, der lieber in der Stadt wohnte, um dort sein Geld zu verprassen, gleich anderen arroganten und faulen Rabiblanco - so wurden diese Leute abfällig genannt - und von einem Verwalter sein Land bewirtschaften ließ. Neben dem Wohnhaus gab es in angemessener Entfernung mehrere Wirtschaftsgebäude und Stallungen. Das ganze Areal war prächtig, wie in einem botanischen Garten, in eine unendliche Vielfalt von Pflanzen eingebettet mit unglaublichen Grünschattierungen der Blätter und Blüten in Farben und Formen, die Cornelius die Sprache raubten. Vor seinen Augen breitete sich eine gepflegte Unordnung aus, wie diese nur über viele Jahre von kundiger Gärtnerhand gepflegt, und einer mit der Natur sehr verbundenen Hausherrin gestaltet werden konnte.
Читать дальше