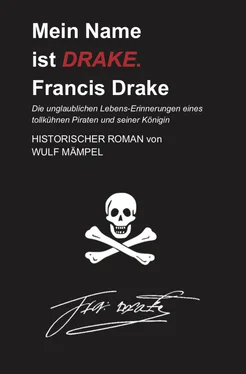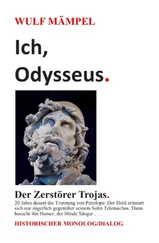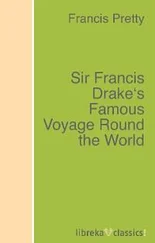Ich sage verärgert: „Ihr müsst geisteskrank sein. Ist das noch ein christliches Gedankengut? Ihr seid brutaler als jeder spanische Eroberer. Männer wie Ihr machen Amerika zu einem Kontinent der Gesetzlosen – unter dem Mantel einer christlichen Mission. Das ist absurd und verwerflich. Ich verachte Euch und Eure Ideen.“
„Und Ihr seid ein kleiner Sklavenhändler, Kapitän Drake, nicht besser als ein Sklavenbesitzer. Was wollt Ihr denn schon an diesem System ändern? Dafür seid Ihr zu klein und unbedeutend.“
Recht hat er, denke ich. Doch ich habe keine Lust, mich mit dem Jesuiten und seinem missionarischen Eifer auseinanderzusetzen – dies ist nämlich meine letzte Reise als Sklavenhändler, der seine Ware bisher erfolgreich am Nigerdelta in Empfang nahm. Der Grund: Die Spanier wollen uns Engländern nicht mehr erlauben, Handel in den von ihnen beherrschten Häfen zu treiben. Damit wäre mein Geschäft beendet, mein Handel pleite. Ich habe neue Pläne: Nach meiner Rückkehr trete ich in die Dienste meines älteren Vetters, des königlichen Kapitäns und Freibeuters John Hawkins.
Auf meine Frage, woher der Jesuit stamme, weiß van Breukelen keine präzise Antwort. Er zuckt seine breiten Schultern: „Vom Himmel gefallen oder aus der Hölle emporgestiegen. Er war eines Tages einfach da. Ein spanisches Schiff spuckte ihn an Land. Das war vor gut drei Wochen. Als ich ihm von Eurem Kommen berichtete, beschloss er, Euch nach Amerika zu begleiten.“
Ich antworte nicht. Ich denke an meine Zukunft – vom Sklavenhändler zum Kapitän der Königin. Ob sie mir den Menschenhandel übel nimmt? Nach den Worten meines Vetters John sei Elisabeth sehr modern, sie blicke immer nach vorn, sie verachte Schmeichler und Speichellecker. Obwohl ich sie noch nicht kenne, entwickele ich eine große Sympathie für die Königin. Wie wird sie mich behandeln? John Hawkins spricht nur in bewundernden Worten von ihr. Sie möge ihn, erzählte er mir, er sei einer ihrer erfolgreichsten Freibeuter, einer der berühmt-berüchtigten Korsaren. Ich möchte einer von ihnen werden! Nur noch diese Fahrt, dann habe ich wieder Geld genug, um mich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Ich brauche nur statt meines Warenschiffes ein richtiges Kriegsschiff, eine mutige Mannschaft und Fortune. Mich locken die Ferne, fremde Welten und Amerika.
Ich bin neugierig, wie die Königin wohl aussehen mag. Man sagt, sie sei keine große Schönheit im üblichen Sinn. Blass, sommersprossig, mit roten Haaren und von eher dürrer Gestalt. Sie habe kaum Busen und sei kein Cello aus Fleisch und Blut. Ihr Verstand sei jedoch zu bewundern, ihre Bildung und ihr Charme würden die kleinen Schönheitsfehler aufwiegen. Elisabeth regiere unbeirrt wie ein Mann mit starker Hand. Bald werde ich es wissen. Nur noch diese eine verdammte Reise . . . dann beginnt mein neues Leben.
Der junge Schwarze, der den Disput zwischen dem Jesuiten und mir verfolgt hat, nimmt das kleine Mädchen behutsam auf den Arm. Sein Gesicht ist voll von Hass. Das Bild rührt mich, ich weiß nicht einmal warum, aber ich beschließe, dem Sklaven und seiner Schwester die Freiheit zu schenken – vielleicht eine Reaktion auf mein schlechtes Gewissen, mehrere Jahre erfolgreich als Sklavenhändler unterwegs gewesen zu sein. Dabei habe ich die menschliche Fracht stets sehr menschlich behandelt: Es gab bei mir nie die Peitsche, die Sklaven erhielten Nahrung und Wasser. Denn je besser ihr Zustand nach der gut vier - bis fünfwöchigen Schiffspassage ist, desto höher ist ihr Preis bei den spanischen Farmern und königlichen Beamten.
Später, nachdem die Sonne im Meer versunken ist, befreie ich unbemerkt die beiden. Der Schwarze blickt mich ungläubig an, als ich ihm erkläre, dass ich ihn und seine Schwester nicht mit nach Amerika nehmen würde. Zum Abschied gibt Mbopo mir die Hand: „Unsere große Gottesmutter, die Mama Afrika, die alle Menschen erschuf, hat Dein Herz berührt. Sie wird eines Tages auch die anderen Sklavenhändler, den weißen Mann insgesamt, bekehren. Ich sage Euch voraus: Niemand sollte der Sklave eines anderen Menschen sein.“
Am nächsten Morgen erklärt mir der Holländer aufgeregt, dass seine Sklavenjäger einen entflohenen Gefangenen und dessen kleine Schwester unweit unseres Lagers gefasst und auf der Stelle getötet hätten . . . Der verrückte Sklave habe tatsächlich alle seine Mitgefangenen befreien wollen. Bei diesem Versuch sei er entdeckt worden. Ich bin schockiert, was ich da höre.
Als dann der Jesuit auch noch einen meiner Lieblingssprüche zitiert: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem, kann ich meinen Wutausbruch nicht mehr unterdrücken: Ich schlage dem Holländer mit meiner Peitsche ins Gesicht, dass die Haut platzt und Blut in Strömen fließt. Den Jesuiten verprügele ich daraufhin, dass er - stark aus der Nase blutend - auf dem Boden liegt. Dann macht Jan Hendrik van Breukelen einen Fehler, indem er mit gezogenem Schwert auf mich losstürmt. Mit aller Kraft und meinem Geschick als Absolvent einer der besten Fechtschulen des Königsreiches pariere ich die wilde, unüberlegte Attacke und ramme dem Sklavenjäger nach einem kurzen Kreuzen unserer Klingen mein Schwert in die rechte Schulter. Laut fluchend bricht der bullige Holländer schwer verletzt zusammen.
Einen Tag später verlassen wir den unwirtlichen Ort und stechen mit den Gefangenen in See - Richtung Karibik. Den Jesuiten lasse ich – mich laut beschimpfend - am Nigerdelta zurück. Sein gehässiger Fluch macht mich lachen. Der Holländer, so erfahre ich noch kurz vor meiner Abreise, sei schwer verletzt, werde aber überleben, wenn ihn nicht das Wundfieber dahinraffe. Weder den Jesuiten, noch den Holländer traf ich jemals wieder. Wahrscheinlich hat sie der Teufel geholt.
Mit dieser Erinnerung beende ich meine erfolgreiche Zeit als Sklavenhändler. An der „Verschleppung Afrikas nach Amerika“, wie der Menschenhandel auch bezeichnet wird, nehme ich nicht mehr teil! Ich beruhige mein Gewissen, indem ich immer wieder folgende Legende erzähle, wenn mich Zweifel und Schuldgefühle plagen: Der Besitz von Sklaven dokumentierte die Macht seit Menschengedenken. Mansa Musa, der Sultan von Mali, verkaufte während seiner Pilgerfahrt nach Mekka im Jahre 1324 in Kairo 14 000 Frauen, um die Reisekosten für sich und sein Riesengefolge aufzubringen. Die Araber waren noch vor den Europäern im Geschäft mit der Ware Mensch aktiv: Für sie ist die Sklaverei selbstverständliches Recht von Herrenmenschen. Muslimische Händler aus Nordafrika rauben seit Jahrhunderten südlich der Sahara „Heiden" oder erwarben Schwarze im Tausch gegen Pferde. . . Der erfolgreichste Sklavenhändler Mitte des Jahrhunderts war Khair ad-Din gewesen, den die Europäer wegen seines roten Bartes „Barbarossa“ nannten. Die spanische Seemacht erhielt eine ernst zu nehmende Konkurrenz in Gestalt dieses Seeräubers und späteren Admirals des Osmanischen Reiches, der das Mittelmeer zu seinem Jagdrevier erklärte. Das Mittelmeer wurde, wie er es nannte, seine private „Badewanne“. Mit äußerster Brutalität ging dieser gefürchtete Pirat zu Werke, er war der Schrecken an den Küsten Nordafrikas.
Als ich auf der Brücke meines Zweimasters „Swan“ am Ruder stehe, blicke ich noch einmal zurück: Der Mord an den beiden Geschwistern macht mir den endgültigen Abschied leicht - Sklaverei ist ein elendes Handwerk. Ich denke über eine alte Weisheit nach, die mir ein erfahrener Seemann vor einiger Zeit in der Karibik erzählte: „Wir reisen an weit entfernte Orte, um fasziniert die fremden Menschen zu beobachten, die wir daheim ignorieren und mit Hass und Missachtung verfolgen.“
John McFinn winkt mir fröhlich zu: „Alles okay an Bord, Kapitän!“ Ich will, ich muss mein Leben ändern und beschließe, nach der Rückkehr aus Amerika mein kleines Handelsschiff zu verkaufen und das Angebot meines Vetters John Hawkins anzunehmen, als ein Kapitän eines seiner Kriegsschiffe in seinen Dienst zu treten. Der Gedanke macht mich glücklich. Johns Abschiedsworte klingen mir noch im Ohr, als er mir lachend erklärte: „Francis, ich glaube es wird nun Zeit, Dich der Königin vorzustellen.“
Читать дальше