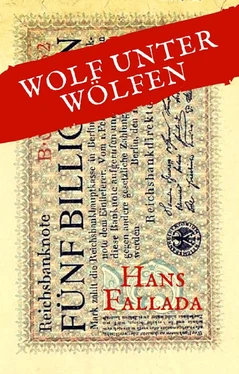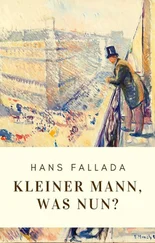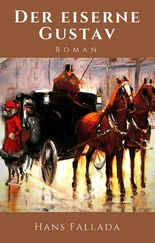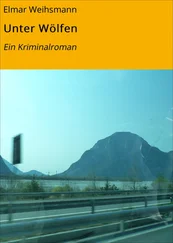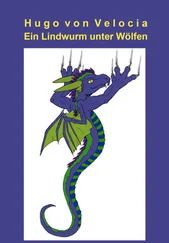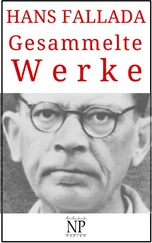Ich muß schnell sehen, daß ich weiterkomme, denkt er. Mit dem Bild unter dem Arm durch ein Gewitter zu laufen wäre nicht angenehm …
Und plötzlich weiß er es. Er sieht sich mit dem Bild, das in irgendein schon benutztes Packpapier geschlagen ist, durch die Straßen zu dem Kunsthändler laufen. Nicht einmal eine Taxe kann er sich leisten. Ein Millionen-, vielleicht ein Milliardenobjekt, aber unter den Arm geklemmt, wie ein Dieb! Heimlich, wie ein Säufer seiner Frau die Betten heimlich aus dem Hause trägt zum „Onkel““.
Aber es ist mein Eigentum, wendet er sich ein. Ich brauche mich nicht zu schämen!
Ich schäme mich doch, sagt er. Es ist nicht recht.
Wieso ist es nicht recht? Sie hat es mir geschenkt!
Du weißt genau, wie sehr sie an diesem Bild hängt. Darum hat sie es dir ja geschenkt, sie wollte dich noch fester an sich binden. Du wirst sie tödlich verletzen, nimmst du es ihr fort.
Dann mußte sie es mir eben nicht schenken. Nun kann ich damit tun, was ich will.
Es ist dir schon öfter schlecht gegangen. Du hast schon öfter an diesen Verkauf gedacht und hast es doch nie getan.
Weil es uns noch nie so schlecht ging. Jetzt ist es eben soweit.
So, ist es das? Wie finden denn andere heraus, die so etwas nicht in Reserve haben?
Andere hätten es nicht soweit kommen lassen. Andere hätten nicht alles gleichgültig treiben lassen, bis es ganz schlecht ging. Andere hätten nicht als letzten Ausweg die Mutter verletzt, um der Geliebten Brot zu geben. Andere hätten nicht bedenkenlos gespielt – bedenkenlos, weil das Bild als Reserve da war. Andere hätten sich beizeiten nach Arbeit umgesehen und hätten Geld verdient. Andere wären nicht gleichgültig versetzen, pumpen und betteln gegangen. Andere hätten nicht von einem Mädchen nur genommen und genommen, ohne sich je den Gedanken zu machen: Was gibst du?
Der Himmel ist jetzt höher hinauf schwarz. Vielleicht wetterleuchtet es da hinten bereits, man sieht es nicht durch den Dunst. Vielleicht grummelt auch schon ferne der Donner, aber man hört ihn nicht. Es donnert, zischt und schreit noch lauter die Stadt.
Du bist feige, sagt es. Arm bist du, vertrocknet mit dreiundzwanzig Jahren. Es war alles da für dich, Liebe und sanfte Sorge, du aber liefest davon. Gewiß, gewiß, du bist jung. Jugend ist ruhelos, Jugend fürchtet sich vor dem Glück, sie will das Glück gar nicht. Denn Glück heißt Ruhe, und Jugend ist ruhelos. Aber wohin bist du gelaufen? Bist du denn zu der Jugend gelaufen? Nein, grade dorthin, wo die Alten sitzen, die den Stachel des Fleisches nicht mehr spüren, die keinen Hunger mehr haben … in die schwelende, trockene Sandwüste der künstlichen Leidenschaften liefest du – schwelend, trocken, künstlich – unjung!
Feige bist du! Jetzt sollst du dich einmal entscheiden. Schon stehst du und zauderst. Du willst die Mutter nicht verletzen und doch dem Peter helfen. Ach, am liebsten wäre es dir, wenn dich die Mutter bitten würde, inständig, mit aufgehobenen Händen bitten würde, doch ja das Bild zu verkaufen. Aber sie wird das nicht tun, sie wird dir die Entscheidung nicht abnehmen, du selbst bist der Mann! Es gibt kein Mittelding, keinen Ausweg, keinen Kompromiß, kein Kneifen. Du hast es zu lange treiben lassen – nun entscheide – eine oder die andere!
Die Wolke steigt höher und höher. Wolfgang Pagel steht noch immer entschlußlos am Fenster. Er ist gut anzusehen, mit schmalen Hüften und breiten Schultern, eine Kämpferfigur. Aber er ist kein Kämpfer. Er hat ein offenes Gesicht, mit einer guten Stirn, einer kräftigen, graden Nase – aber er ist nicht offen, er ist nicht grade. In ihm kommen und gehen viele Gedanken, alle sind sie unangenehm, peinigend. Alle verlangen sie etwas von ihm, er ist böse, daß er solche Gedanken denken muß.
Andere haben es besser, denkt er. Die tun, was ihnen paßt, und machen sich keine Gedanken. Bei mir ist alles schwierig. Ich muß es mir noch einmal überlegen. Gibt es denn keinen Ausweg – Mutter oder Peter?
Eine Weile hält er sich stand, er gibt sich Mühe, will dieses Mal der Verantwortung nicht ausweichen. Aber allmählich, wie er keinen Ausweg findet, wie alles immer wieder die Entscheidung von ihm fordert, wird er müde. Er brennt sich eine Zigarette an, er trinkt noch einen Schluck Kaffee. Er öffnet leise die Zimmertür und lauscht in die Wohnung. Es ist alles still, Mutter ist noch nicht zurück.
Er hat blondes, gekräuseltes Haar, sein Kinn ist nicht sehr stark – er ist weich, er ist schlaff. Er lächelt, er hat seinen Entschluß gefaßt. Wieder einmal ist er der Entscheidung ausgewichen. Er wird die Abwesenheit der Mutter benutzen und ohne Auseinandersetzung mit dem Bilde gehen. Er lächelt, plötzlich ist er völlig zufrieden mit sich, die quälenden Gedanken sind fort.
Er geht schnurstracks über den Flur, auf Vaters Zimmer zu. Er hat keine Zeit zu verlieren, das Gewitter ist am Losbrechen, Mama kann jeden Augenblick zurückkommen.
Er öffnet die Tür zu seines Vaters Zimmer, und da, grade vor ihm, in dem großen Lehnstuhl, sitzt schwarz, steif, aufrecht die Mama –!
„Guten Tag, Wolfgang!““ sagt sie. „Ich freue mich!““
Er freut sich gar nicht. Im Gegenteil: er kommt sich wie ein erwischter Hausdieb vor.
„Ich dachte, du machtest Besorgungen, Mama““, sagt er verlegen und gibt ihr schlaff die Hand, die sie energisch und mit Bedeutung drückt.
Sie lächelt. „Ich wollte dir Zeit lassen, dich wieder zu Haus zu fühlen, wollte dich nicht gleich überfallen. Nun, setze dich, Wolfgang, steh nicht so unentschlossen herum … Du hast doch jetzt nichts vor, bist nicht auf Besuch hier, bist zu Hause …““
Gehorsam setzt er sich, sofort wieder Sohn, unter mütterlichem Befehl und Vormundschaft. „Doch auf Besuch! Bloß auf einen Sprung““, murmelt er wohl, aber das überhört sie, ob willentlich oder wirklich, wird er später erfahren.
„Der Kaffee war noch heiß, ja? Gut. Ich hatte ihn eben gebrüht, als du kamst. Gebadet und umgezogen hast du dich noch nicht? Nun, das hat Zeit. Ich verstehe, du wolltest erst einmal unser Heim ansehen. Es ist eben doch deine Welt. Unsere““, setzt sie abschwächend hinzu, denn sie beobachtet sein Gesicht.
„Mama““, fängt er an, denn diese Betonung der Welt hier, die Unterstellung, die Thumannsche Höhle sei Petras Welt, ärgern ihn. „Mama, du irrst dich sehr …““
Aber sie unterbricht ihn. „Wolfgang““, sagt sie in einem andern, viel wärmeren Ton, „Wolfgang, du brauchst mir nichts zu erzählen, gar nichts zu erklären. Vieles weiß ich, alles brauche ich nicht zu wissen. Um aber von Anfang an nichts unklar zu lassen, möchte ich dir für dieses eine Mal erklären, daß ich mich nicht ganz richtig gegen deine Freundin benommen habe. Ich bedaure vieles, was ich gesagt habe, mehr noch eines, was ich getan habe. Du verstehst mich. Genügt dir das, Wolfgang? Komm, gib mir deine Hand, Junge!““
Wolfgang sieht seiner Mutter prüfend ins Gesicht. Er will es erst nicht glauben, aber es ist kein Zweifel, er kennt doch seine Mutter, kennt ihr Gesicht, sie meint es aufrichtig. Sie bedauert, sie bereut. Sie hat ihren Frieden mit ihm und mit Peter gemacht – sie ist also versöhnt, weiß der Himmel, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht hat die Wartezeit sie weich gemacht.
Fast ist es nicht zu glauben. Er hält ihre Hand, er will nun auch nicht mehr Verstecken spielen, er sagt: „Mama, das ist sehr nett von dir. Aber sicher weißt du noch nicht, wir wollten heute heiraten. Es ist nur …““
Sie unterbricht ihn schon wieder – welche Bereitschaft, welches Entgegenkommen, sie macht ihm alles leicht! „Es ist gut, Wolfgang. Es ist ja nun alles erledigt. Ich freue mich so, daß du wieder hier sitzt …““
Ein Gefühl ungeheurer Erleichterung überkommt ihn. Eben noch stand er am Fenster seines Zimmers, von Zweifeln gequält, wen er verletzen sollte: Mutter oder Petra. Es schien keinen Ausweg zu geben, nur diese zwei Möglichkeiten. Und schon hatte sich alles gewandelt: die Mutter hatte ihren Fehler eingesehen, der Weg in dieses geordnete Heim stand ihnen beiden offen.
Читать дальше