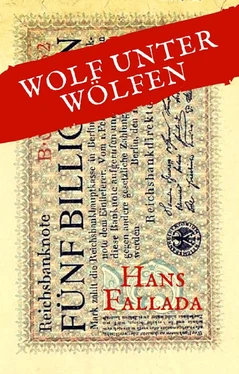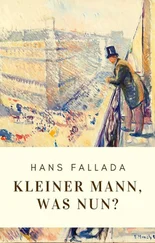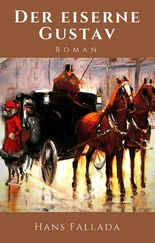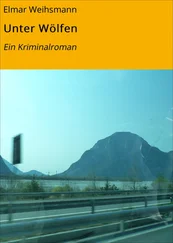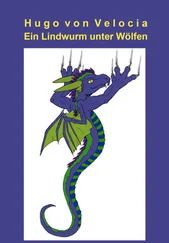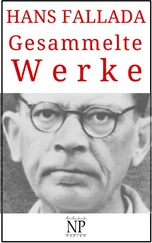Aber dieser Blick, der ihn aus den Augen des Mädchens traf, als er ihr die Hand auf die Schulter legte, dieser flammende und doch klare Blick, gequälte Kreatur, doch mißachtend ihre Qual – dieser Blick zerstreute jeden Gedanken an Alkohol. In einem ganz andern Ton fragte er: „Sind Sie krank?““
Sie lehnte an der Wand. Undeutlich nur waren ihr die Uniform, der Tschako, das rosige, volle Gesicht mit dem rötlichblonden strubbligen Bart vor Augen. Undeutlich war ihr, wer sie fragte, wem sie antworten sollte, was sie zur Antwort sagen sollte. Doch versteht vielleicht keiner so gut wie ein ordentlicher Mensch, der alle Tage mit aller Unordnung der Welt zu kämpfen hat, welchen Umfang diese Unordnung annehmen kann. Aus wenigen Fragen, mühsamen Antworten hatte sich Oberwachtmeister Gubalke rasch ein Bild des Sachverhalts aufgebaut, er wußte auch schon, daß nur auf ein paar Schrippen gewartet werden sollte, daß das Mädchen dann vorhatte, um die Ecke zum „Onkel““ zu gehen, der ihr bestimmt mit einem Kleid aushelfen würde, daß dann irgendwelche Freunde oder Verwandte des Mannes aufgesucht werden sollten (das Fahrgeld hatte sie in der Hand) – kurz, daß das Ärgernis aller Voraussicht nach in wenigen Minuten beseitigt sein würde …
All dies erfuhr der Oberwachtmeister, wußte es nun, und schon war er im Begriff zu sagen: Also gut, Fräulein, dies eine Mal will ich es Ihnen noch durchlassen, und zu Wache und Dienst zu gehen, als ihn peinlich der Gedanke anfiel, wann er denn eigentlich auf der Wache eintreffen würde –? Ein Blick auf seine Armbanduhr belehrte ihn, daß es drei Minuten vor vier Uhr war. Vor vier Uhr fünfzehn würde er unter keinen Umständen auf der Wache sein können. Fünfzehn Minuten Dienst versäumt – und mit welcher Entschuldigung –?! Daß er mit einem recht unsittlich bekleideten Frauenzimmer diese Viertelstunde verplaudert hatte, ohne zu einer Diensthandlung zu schreiten! Unmöglich – jeder würde denken: Der Gubalke hat einfach verpennt!
„Unmöglich, Fräulein““, sagte er dienstlich. „Ich kann Sie unmöglich so auf die Straße lassen. Erst einmal müssen Sie mit mir mitkommen.““
Sanft und doch fest legte er ihr die behandschuhte Hand auf den Oberarm, sie sanft, aber doch fest haltend, ging er mit ihr auf die Straße, auf die er sie unmöglich lassen konnte. (Ordnung bringt oft so Widersinniges mit sich.)
„Ihnen passiert gar nichts, Fräulein““, sagte er tröstend. „Sie haben ja nichts ausgefressen. Aber ließe ich Sie so auf die Straße, könnte es Erregung öffentlichen Ärgernisses und Schlimmeres werden, und dann hätten Sie was ausgefressen.““
Das Mädchen geht willig neben ihm her. Der Mann, der sie so nicht ohne Sorgsamkeit führt, hat nichts an sich, was einen unruhig machen könnte, obwohl er eine Uniform trägt. Petra Ledig, die sich, gar nicht lange her, noch unsinnig vor jedem Polizisten geängstigt hat, damals, als sie noch unerlaubt ein wenig auf die Straße ging, Petra merkt, daß Polizisten in der Nähe nichts Beängstigendes zu haben brauchen, sie haben sogar etwas Väterliches.
„Auf der Wache sind wir zwar nicht darauf eingerichtet““, sagt er grade, „aber ich werde schon sehen, daß Sie gleich was zu essen kriegen. Die auf der Meldeabteilung haben meist nicht soviel Hunger, da werde ich schon ein Butterbrot fassen.““ Er lacht. „So ein fremdes Butterbrot, ein bißchen angetrocknet und in zerknittertem Stullenpapier, ist grade was Schönes. Wenn ich meinen Gören mal so was mitbringe, sind sie immer ganz wild darauf. Hasenbrot nennen sie das. Sagen Sie auch so dafür?““
„Ja““, sagt Petra. „Und wenn Herr Pagel mir mal ein Hasenbrot mitbrachte, habe ich mich auch immer gefreut.““
Bei der Erwähnung des Herrn Pagel macht der Oberwachtmeister Leo Gubalke sein dienstlichstes Gesicht. Trotzdem Männer einander immer beistehen müssen, und zumal gegen die Weiber, ist er gar nicht einverstanden mit diesem jungen Herrn, der noch dazu ein Spieler sein soll. Dem jungen Mädchen wird er nichts davon sagen, aber er hat doch vor, sich die Lebensführung dieses Herrchens etwas näher anzusehen. Sehr anständig hat sich dieser Herr Pagel kaum benommen, und es ist nur gut, so ein Luftikus merkt mal, man sieht ihm auf die Finger.
Der Oberwachtmeister ist verstummt, er schreitet schneller aus. Das Mädchen geht willig mit, es ist nur gut, wenn sie rasch aus dieser Anglotzerei fortkommt. So entschwinden die beiden, gegen die Wache hin – und umsonst kommt der Diener Ernst mit seinen Schrippen, umsonst wird das Mädchen Minna der Frau Gesandtschaftsattaché Pagel sich nach ihr erkundigen, umsonst fährt in Dahlem der üppige Maybach los, in dem eine Dame mit einem blinden Kinde sitzt.
Umsonst auch zerstreitet sich um diese Zeit Wolfgang Pagel endgültig mit seiner Mutter.
Petra Ledig ist fürs erste einmal aller zivilen Einwirkung entzogen.
Wolfgang Pagel ist Schritt für Schritt, ohne sonderliche Hast, aber auch ohne einmal anzuhalten, den weiten Weg von den Villen der Reichen in Dahlem über die durchwimmelten Straßen Schönebergs bis in den alten Berliner Westen gegangen. Er kam durch viele Straßen, in denen außer ihm kaum ein Mensch ging, durch leere, verlassene, wie von der Sonne kahlgebrannte Straßen. Und wieder ging er andere Wege, die vom Verkehr durchbraust waren, wimmelte mit den Wimmelnden, trieb ziellos zwischen den Zielstrebenden.
Über ihm hing der Dunst aus Schwüle und Atem der Stadt. Als Pagel zwischen den Baumalleen Dahlems ging, warf er noch einen klaren, scharfen Schatten. Je tiefer er sich aber in der Stadt verlor, um so mehr verblaßte der Schatten, grau verschmolz er mit dem Grau der Granitplatten auf dem Gehsteig. Nicht allein die Mitwimmelnden löschten ihn aus, nicht nur die immer steiler und enger über ihm ragenden Hauswände, nein, der Dunst wurde dichter, die Sonne blasser. Die Hitze, die sie ständig in die überhitzte Stadt schleuderte, löschte sie aus.
Noch war nichts von Wolken zu sehen. Vielleicht lauerten sie schon hinter den Häuserreihen, geduckt längs dem verborgenen Horizont, bereit, hochzusteigen, sich mit Feuer, Donner und strömender Nässe zu ergießen, vergeblicher Einbruch der Natur in eine künstliche Welt.
Wolfgang Pagel geht darum nicht schneller. Zuerst ist er ohne bestimmtes Ziel losgegangen, nur aus dem Gefühl heraus, daß er in jener Herrschaftsküche nicht mehr sitzen dürfe. Dann, als ihm plötzlich das Ziel seines Marsches klar war, ging er darum nicht schneller. Er ist immer ein gemächlicher Mensch gewesen, mit Wissen und Bewußtsein war er langsam, gerne machte er eine Handbewegung, ehe er auf eine Frage Bescheid gab: das schob die Antwort ein wenig hinaus.
Auch jetzt geht er langsam; er schiebt die Entscheidung ein wenig hinaus! In der Küche, beim Gespräch mit dem blinden Kinde hatte er noch gemeint, die Sorge um Petra anderen Menschen überlassen zu müssen. Er hatte nämlich gedacht, er könne Petra nicht helfen. Hilfe für ein Mädchen ohne Kleider, ohne Essen, mit Schulden konnte nur Geld heißen, er aber hatte kein Geld. Dann aber war ihm eingefallen, daß er doch Geld hatte oder, wenn auch nicht Geld, so doch etwas, das ebensoviel wert war wie Geld. Um es genau zu sagen, hatte von Zecke ihn auf den Gedanken gebracht: er besaß ein Bild. Dieses Bild, Junge Frau am Fenster, gehörte unbestreitbar ihm. Er erinnerte sich wohl, wie seine Mutter, als er ins Feld ging, gesagt hatte: „Dieses Bild gehört jetzt dir, Wolf. Denke im Felde immer daran: Vaters schönstes Bild wartet hier auf dich.““
Er fand es nicht sehr schön, aber es würde seinen Marktpreis haben. Zecke würde er den Gefallen nicht tun, aber es gab Kunsthändler genug, die einen Pagel gerne nahmen. Wolfgang entschied sich für einen großen Kunsthändler in der Bellevuestraße. Dort würde man es bestimmt verschmähen, ihn zu übervorteilen, ein Pagel war auch ohne Übervorteilung ein Geschäft.
Читать дальше