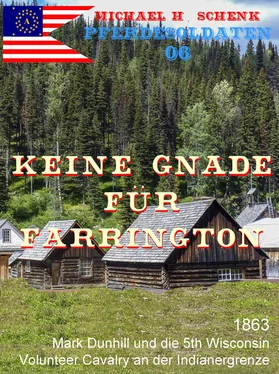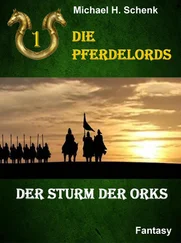„Ihr Weißen lebt anders, als wir Indianer. Ihr siedelt an einem festen Ort, betreibt Viehzucht und Ackerbau. Der rote Mann hingegen folgt dem Büffel.“ Many Horses hielt das geleerte Glas seinem Gastgeber hin und der Graf schenkte nach. „Der weiße Mann kommt in unser Land und nimmt sich, was ihm gefällt. Er gründet seine Städte und vertreibt den Büffel. Der Weiße breitet sich immer weiter aus, mein weißhaariger Freund, und was man ihm nicht bereitwillig überlässt, das nimmt er sich mit Gewalt. Dann gibt es Krieg mit seinen Soldaten, bis man Frieden macht und einen Vertrag schließt. Mit jedem Vertrag wird das Land des roten Mannes kleiner und das Land des weißen Mannes größer.“ Die Stimme des Chiefs klang bitter. „Doch der Hunger der Weißen ist nicht zu stillen. Viele von uns hoffen, dass sich die Weißen nun gegenseitig umbringen.“ Er sah sein Gegenüber forschend an. „Weißt du, mein weißhaariger Freund, warum die Weißen jetzt in den Krieg ziehen?“
„Nun, ich muss zugeben, dass ich es nicht wirklich weiß“, räumte von Trauenstein ein. „In der Zeitung steht, dass es schon seit vielen Jahren Differenzen zwischen den Staaten des Nordens und des Südens gibt. Es geht wohl um Leibeigene und Sklaven.“
„Leibeigene und Sklaven?“
„Das sind Menschen, die anderen Menschen gehören und ihnen dienen müssen.“
„Menschen, die Menschen gehören?“ Many Horses überlegte angestrengt. „Ah, ich verstehe. Gelegentlich haben wir gefangene Crows oder deren Weiber die für uns arbeiten müssen.“
„Es sind keine Gefangenen. Die meisten Sklaven sind wohl Neger, die von dem fernen Kontinent Afrika stammen oder hier geboren wurden. Es gibt wohl Märkte, auf denen man mit ihnen handelt. Äh, wie Pferde, denke ich.“ Von Trauenstein sah sich um und rief seine Tochter herbei. „Josefine kann es besser erklären, Chief. Sie interessiert sich mehr für solche Dinge, als ich.“
Die junge Frau kam zu ihnen und der Chief gab ihre mit einer Geste zu verstehen, dass sie sich setzen solle. Dies war eigentlich ein Gespräch unter Männern, doch der Häuptling war wissbegierig und bereit, den Ausführungen von Josefine zuzuhören.
Was sie zu sagen hatte, traf bei Many Horses auf Unverständnis. „Für diese Menschen wäre es besser, tot zu sein. Wir könnten nicht einmal in festen Häusern leben, da wir uns dann wie Gefangene fühlen würden, doch ihr Weißen legt die schwarzen Menschen auch noch in Ketten, zwingt sie zur Arbeit und handelt sie wie Pferde.“
„Mein Vater und ich halten nichts von Sklaverei oder Leibeigenschaft“, versicherte Josefine. „Und viele andere Menschen verurteilen sie ebenfalls. Deswegen führen der Norden und der Süden ja auch Krieg gegeneinander. Der Süden hält Sklaven und der Norden will sie befreien.“
Der Graf räusperte sich. „Kind, ich denke, so einfach ist es nicht. Auch im Norden gibt es Staaten, in denen Sklaven gehalten werden.“
Many Horses lachte leise. „Für euch sind schwarze Menschen wie Pferde. Wir führen keine Kriege wegen Pferden.“ Er lachte erneut. „Aber es bereitet uns Freude, in das Gebiet der Crows zu reiten, ihnen Pferde zu stehlen und bei der Gelegenheit auch ein paar Skalpe zu erbeuten.“
„So etwas ist barbarisch“, entfuhr es Josefine.
„Josefine!“, mahnte ihr Vater.
„Einen besiegten Feind zu verstümmeln ist barbarisch“, bekräftigte die junge Frau.
„Es ist ein Ritual, dass von unseren Vorfahren schon lange praktiziert wurde, bevor der erste von euch Weißen unser Land betrat.“ Many Horses erwiderte Josefines Blick. „Für uns ist es eine Trophäe und der Beweis für die Tapferkeit des Kriegers. Ihr Weißen hingegen bezahlt sogar für Skalpe. Wenigstens, wenn es die von Indianern sind.“
Graf von Trauenstein runzelte die Stirn, doch seine Tochter nickte. „Der Chief hat recht, Vater. In einer der älteren Zeitungen stand, dass man in Texas Prämien für Indianerskalpe bezahlt hat.“
„Nun, ich finde die rituellen Tänze unserer roten Freunde weitaus interessanter“, versuchte der Graf das Gespräch auf ein anderes Gebiet zu lenken. Die Deutschen fanden einige der Gebräuche der Sioux äußerst befremdlich und sogar barbarisch, doch sie lebten in Farrington, da die Indianer ihnen dies erlaubt hatten und fanden es daher unangemessen, die Indianer zu kritisieren.
„Bei dem großen Pow Wow wird es viele Tänze geben“, ging Many Horses auf den Gesprächswechsel ein. „Und viele Gespräche. Über die Weißen und ihren Krieg.“
„Auch bei uns spricht man über diesen Krieg, mein roter Freund. Glücklicherweise berührt er uns nicht. Farrington liegt weitab. Wir und unsere roten Freunde werden von den Wirren dieses Konfliktes verschont bleiben.“
Kapitel 2 Kein Mann des Nordens
Der ehemalige Handelsposten der American Fur Company lag direkt im Norden von Josefine´s Saloon, gute zweihundert Yards von diesem entfernt. Dreihundert Yards weiter begann der nördliche Wald. Von der einstigen Anlage standen nur noch zwei massive Blockhäuser. Eines von ihnen bewohnte Pecos Bill mit seiner Frau Little Bird, in dem anderen handelte er mit den Indianern.
Am Pecos River in Texas geboren, trug der Fluss zur Namensgebung von Bill bei, als dieser vor etlichen Jahren von der Abenteuerlust gepackt wurde und als Trapper in den Norden ging. Er schloss sich der AFC an und war mit einem ihrer Fallenstellertrupps unterwegs. Während einer dieser Unternehmungen wurde er bei einem Unfall verletzt und die Kameraden ließen ihn bei einer Gruppe befreundeter Santee-Sioux zurück, die ihn gesund pflegten. Während seiner Genesung lernte er Little Bird kennen und lieben. Damals war der „kleine Vogel“ eine zierliche Schönheit, inzwischen hingegen sichtlich gerundet. Doch sie war eine gute und folgsame Frau und hatte viel dazu beigetragen, dass Pecos Bill zu einem erfolgreichen Händler wurde, als er den Handelsposten in Farrington übernahm.
Bill war groß und stämmig, und trug einen dichten schwarzen Vollbart, in dem sich die ersten silbergrauen Haare zeigten. Er trug bequeme Mokassins, eine der robusten Hosen von Levi Strauss und darüber ein Lederhemd, welches seine Frau liebevoll mit indianischen Stickereien verziert hatte. An Stelle eines Hutes bevorzugte er eine Fellmütze.
Bill und Little Bird machten Inventur und gingen durch die Regale im Verkaufsraum. Die Waren ähnelten jenen im Gemischtwarenladen von Josefine, in deren Saloon, und doch gab es Unterschiede. Hier waren die Stoffballen nicht so fein, denn Indianerinnen interessierten sich nicht für die Kleider der Weißen, an Stelle von feinem Porzellan gab es hier Keramik und emailliertes Blechgeschirr, bunte Wolldecken, Werkzeuge, Glasperlen und viele andere Dinge, die ein Indianerherz höher schlagen ließen.
Das Ehepaar wechselte gerade zum nächsten Regal, als Hubertus Keil, der Schmied der Siedlung, zu ihnen in den Laden kam. Keil entsprach nicht den allgemeinen Vorstellungen eines Schmiedes, denn er war klein und von zierlicher Gestalt, wenn auch durchaus muskulös. Dennoch war er unbestritten ein Könner seines Handwerks. Es gab in Farrington kaum einen Nagel, Beschlag oder ein Werkzeug, welches nicht unter seinen Händen entstanden war.
Für Bill und seine Frau war der Schmied ein wertvoller Handelspartner, denn Messer und Beile gehörten nicht zu jenen Waren, deren Handel mit Indianern verboten war. Die Roten schätzten die schweren und scharfen Klingen, die Keil schmiedete und ebenso die Axtköpfe, die er fertigte und die nicht nur dazu geeignet waren, in Holz geschlagen zu werden.
In den letzten Tagen hatte Keil an einem Auftrag von Bill gearbeitet und präsentierte nun stolz das Ergebnis. Er trat an die Ladentheke, schlug ein gefaltetes Tuch auseinander und ließ dreieckige metallene Spitzen auf den Tresen regnen. „Einhundert Stück, Bill. Allerbeste Qualität. Gehärtet und geschärft. Die gehen durch jedes Büffelfell, wie ein glühendes Messer durch Butter.“
Читать дальше