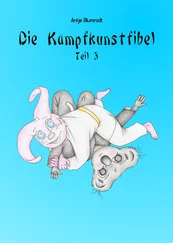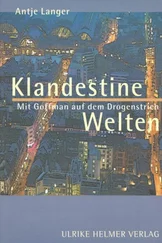Bislang begegneten wir unseren Mitgeschöpfen in einer sehr respektvollen Weise, d.h., wir hatten auch dann Achtung vor dem Leben, wenn es mehr als vier Beine hatte.
Dann sind wir vor etwas mehr als einem Jahr nach Costa Rica umgezogen.
Einer der Gründe dafür, dass wir unsere Haltung zu zumindest manchen Angehörigen der tropischen Fauna änderten, sind Lanzenottern, sehr unangenehme Lebewesen, übrigens ohne Beine, die auch die Ursache dafür sind, dass jeder Einwohner eine Machete besitzt, mit der er ein solches Tier bei Begegnung sofort in möglichst viele Teile zerkleinert. Die Lanzenottern sind auch der Grund dafür, dass wir das Bett am Pool nächtens nicht nutzen. Man weiß nie, wo sich die Geschöpfe zur Nacht betten.
Weitere Situationen, die unsere europäischen Nerven immer wieder auf die Probe stellen – man könnte sie auch als Zermürbungstechnik der Umstände bezeichnen –, führen gleichzeitig zu einer erstaunlichen Hartnäckigkeit, mit der wir an unserem neuen Dasein festhalten, welches die widrigen Umstände begleitet. Ich schildere in den Episoden dieses Buches die Dinge, die uns im mittelamerikanischen Alltag daran erinnern, dass wir einen letzten Nerv haben. Ich tue dies aus unbestritten subjektivem Blickwinkel und aus einem tief empfundenen Gefühl der Sympathie nicht nur für die, die bereits zu Schlangenmördern geworden sind.
Imprint
Im Schlangenmörderparadies
Antje Tiedemann
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2012 Antje Tiedemann
ISBN 978-3-8442-3396-4
Eine Art Einleitung: Bloß weg hier…
… haben wir uns gedacht. Auch der Klimawandel sorgt für keinen überzeugenden Sommer in Deutschland. Und drei Viertel des Jahres kalte Füße zu haben ist ja kein Zustand. Zur Erläuterung sei hinzugefügt, dass ich selbstverständlich mit Socken ins Bett ging; ich führte in den Wintermonaten – also Oktober bis April – zusätzlich zu meinen Füßen noch diese lustigen kleinen Wärmekissen, die man durch Knicken eines Metallplättchens aktiviert, in meine Socken ein. Kein Wunder, dass wir keine Kinder hatten.
Nicht nur aus diesem Grund fühlten wir uns niemandem verpflichtet und hatten auch sonst unseren jeweiligen Eltern nicht viel mehr Kummer als unbedingt nötig gemacht. Somit fanden wir, es sei an der Zeit, den ewigen Sommer direkt vor der Tür zu haben, das Meer und den Urwald, die man versucht, so oft es geht im Urlaub zu genießen, in Schlagweite zu haben, den ganzen Tag draußen verbringen zu können, ein Sofa auf der Terrasse, ein Bett am Pool… Und auch: dem Trott zu entfliehen, in der Mitte des Lebens mal etwas ganz anderes zu machen, ein (sorgfältig abgesichertes) Wagnis einzugehen, während das Umfeld sich mit der Krise in dieser Lebensmitte herumschlägt.
Wir haben also nachgedacht und vorgesorgt, so viel wie nötig entschieden und so viel wie möglich offen gelassen und haben dann das mit dem Kummer unserer Eltern nachgeholt: Wir sind umgezogen, nach Mittelamerika, genauer: nach Costa Rica. Gemeinhin nennt man das Auswandern, dieser Begriff setzt aber ungefragt eine Assoziationskette in Gang, die bei halbprofessionellen Fernsehteams beginnt und beim tränenreichen, für jedermann – außer für die Auswanderer – vorhersehbaren Scheitern der Protagonisten endet.
Sie haben vom Bruder eines entfernten Bekannten von entsprechenden Fernsehbeiträgen gehört und kennen die Zusammenhänge: Die Auswanderer waren in ihrer Heimat nur mäßig erfolgreich und glaubten folglich, man habe in der Ferne nur auf sie gewartet. Am Zielort angekommen, bemerken sie überrascht, dass niemand ihre Sprache spricht usw.
Bei uns ist selbstverständlich alles ganz anders. Unser tränenreiches Scheitern ist als ein nicht vorhersehbares geplant. Nach unserem Entschluss hatten wir vier Jahre Zeit, die großen und die kleinen Dinge vorzubereiten, allem voran, die Landessprache zu erlernen. Diese Zeitspanne erwies sich als zu lang, sodass wir uns zwischendurch versehentlich doch noch fortpflanzten. (Dies verschärfte die Sache mit dem elterlichen Kummer nicht unwesentlich; jetzt ließen wir neben verwunderten Arbeitgebern nicht nur sorgenvolle Eltern zurück, sondern auch weinende Großeltern.) Es gab Schwierigkeiten: Alles, was nach der Vereinigung von Eizelle und Spermium geschah, war für uns nicht mehr vorhersehbar. Wir kämpften in der verbleibenden Zeit mit der Fremdbestimmung durch einen Minderjährigen und kamen zu gar nichts mehr. Folglich wunderten wir uns bei der Ankunft in unserer neuen Heimat nicht darüber, dass unsere zweieinhalb VHS-Kurse Spanisch nur bedingt für eine gepflegte Konversation ausreichten. Übrig blieb das Vorhaben, das unser Auskommen sichern sollte, die Speiseeisherstellung, denn in Costa Rica gibt es bislang nach unseren Erfahrungen keine akzeptable Eiscreme zu einem vernünftigen Preis, obwohl das Wetter etwas anderes nahelegt. Insofern hatte man zumindest in dieser Hinsicht nur auf uns gewartet.
Die Idee, andere Menschen an unseren Erfahrungen teilhaben zu lassen, kam mir beim Belauschen eines Telefonats meines Mannes mit einem Mann, der mir unerwartet als mein Gärtner vorgestellt wurde. Ein Nachbar hatte den ca. 1,50 m großen Mann, der von allen Toro (Stier) genannt wird, empfohlen. Bei der ersten Begegnung wünsche er sich mit Blick auf den das Haus umgebenden Dschungel eine Machete, die wir mit Blick auf den das Haus umgebenden Dschungel zusicherten, und ich wünschte mir, er verstände von Gartenarbeit etwas mehr als von Zahnpflege, seinen Mund zierte nämlich noch genau ein Zahn.
In dem erwähnten Telefonat also versuchte der mehr und mehr in Verzweiflung geratende Gatte einen Termin mit dem Stier auszumachen. Auf die wiederholt, in einwandfreiem Spanisch gestellte Frage, um wie viel Uhr er denn morgen zu kommen gedenke („A qué hora?“), bekam er die immer gleiche Antwort: „Mañana!“ (Morgen). Der Gatte: „Si, si, claro, mañana. Pero (Aber), a qué hora?“ Toro: „Mañana!“
Am nächsten Tag (Wir blieben einfach zu Hause, um zu jeder Uhrzeit verfügbar zu sein.) erläuterten wir Toro, welche Gewächse er entfernen könne und welche wir ganz hübsch fänden. Er nickte permanent mit dem Kopf, lächelte nachsichtig, wobei er viel Zahn zeigte, und äußerte ununterbrochen „basura“ (Müll). Wir wiederholten unser Anliegen – verständnisvolles Nicken und Lächeln – und ließen ihn bei seiner anschließenden lautstarken Tätigkeit nicht aus den Augen. Er zog, wild mit der Machete um sich schlagend und „basura“ murmelnd, durch den Garten, und als wir von unseren eigenen Arbeiten versehentlich aufsahen, mussten wir feststellen, dass er – mal abgesehen von den Palmen mit einem Stammdurchmesser von einem halben Meter – nur ein einziges Bäumchen hatte stehen lassen.
In einem späteren Gespräch gab unser Nachbar zu, seine Kommunikation mit Toro laufe auch nicht immer einwandfrei.
Da ich der etwas altmodischen Ansicht bin, dass die intime Teilnahme an unseren ganz konkreten Vorbereitungen und Umsetzungen den Verwandten und Freunden vorbehalten sein sollte, Mitteilungen darüber, was in jedem einzelnen Moment getan und täglich gegessen sowie ausgeschieden wird, hingegen ausschließlich auf Facebook erscheinen sollten, entschied ich mich für eine Schilderung derjenigen Situationen, die ich für typisch halte und die die nicht alltäglichen Umstände unseres Alltags aus erster Hand, in einer Mischung aus kritischer Distanz und höchster Emotionalität, darstellen. Anders gesagt, ich möchte die Dinge erzählen, die einen zum Wahnsinn treiben können, es sei denn, man schreibt sie auf. Ich nenne sie „Detailbetrachtungen“ und übertreibe die Darstellung ein wenig, sodass eine Ähnlichkeit mit lebenden Personen zwar beabsichtigt, aber beinahe nur noch zufällig erkennbar ist.
Dem, der sich am Schluss fragt, warum wir eigentlich nicht ganz gepflegt die Nerven verlieren, sei gesagt: Wir leben im besten Klima der Welt! (Laut der offiziellen Angabe herrscht dieses im zentralen Hochland Costa Ricas.)
Читать дальше