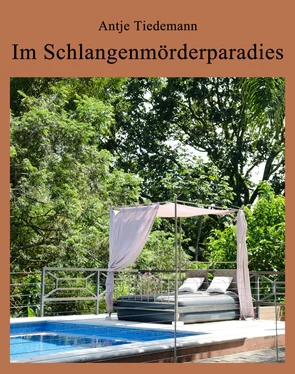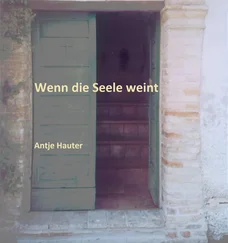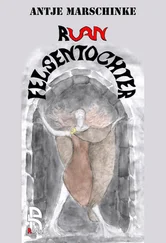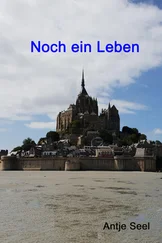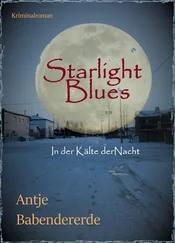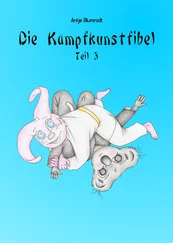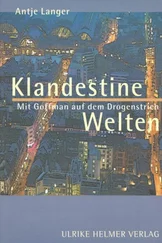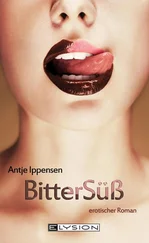Am nächsten Tag ereignet sich dann das, was Eltern von Zwei-bis Dreijährigen als „Supermarktszene“ bekannt ist. Als kleiner Exkurs sei erwähnt, dass unser Sohn im Supermarkt niemals schimpfen oder schreien würde, denn er geht gerne einkaufen und nimmt freundlichen Kontakt zu seinen Mitmenschen auf – besonders zu der Dame hinter der Wursttheke, die die laut vorgetragene Forderung nach einer „Scheibe Wurst“ in der Regel bereits im Eingangsbereich in Wiederholung anhören kann. Als dieser Sohn also von seiner erwartungsfrohen Mutter zum weiteren Aufenthalt im trauten und für die kindliche Entwicklung anregenden Elternhaus abgeholt wird, freut er sich zunächst angemessen, zögert dann kurz und verfällt in ein nicht enden wollendes, unermesslich schrilles Gebrüll, dem einzelne Sätze zu entnehmen sind: „Ich will nicht nach Hause!“ „Mama, geh weg!“ „Fahr wieder weg!“ Unter lauten Klagerufen und Verzweiflungsvorträgen und -taten meinerseits ziehen wir uns zappelnd vom Tatort zurück.
Den Rest des Tages wird in Momenten der Trauer und Unzufriedenheit immer wieder „Ich will wieder zu Marie!“ eingestreut. Aus der Rückschau hat dieser Wunsch alle bisherigen Forderungen, die bei persönlich empfundener großer Not geäußert werden, ersetzt.
Es ist ein unter ängstlichen Naturen weit verbreitetes Gerücht, dass Kinder sich nur in der Obhut der nächsten leiblichen Anverwandten seelisch unbelastet entfalten können. Dabei wissen erfahrene Eltern, dass die Förderung der kindlichen Selbstständigkeit die Bewältigung auch von zunächst als Zumutung empfundenen Zuständen unerlässlich macht.

Obwohl wir uns auf dem amerikanischen Kontinent befinden, kann man hier Lebensmittel käuflich erwerben, deren Bestandteile natürlichen Ursprungs sind und die Fett enthalten. Man wird auch an der Kasse nicht verhaftet, wenn man sie kauft. Allerdings erregt man das Misstrauen der Mitmenschen, wenn man freundlich nach Produkten ohne Zuckerzusätze fragt oder den Sinn intensiver Lebensmittelfarbe bezweifelt. Eine Bekannte hat einmal den Verzehr eines Stückes einer Costa Ricanischen Hochzeitstorte aus Gründen der Höflichkeit nicht ablehnen können. Diese Torten sehen in der Regel aus, als richte Barbie die dazugehörige Festlichkeit nach dem ausgiebigen Konsum mehrerer Tonnen kolumbianischer Drogen aus. Selbst ihre sorgsamst ausgewählten Argumente – Diät, Fastenzeit, Allergie gegen Kohlenhydrate aller Art – konnten die Bekannte nicht vor dem Verzehr bewahren und auch die Größe des dargebotenen Tortenstücks nicht beeinflussen. Die Bekannte gibt an, den Gehalt an Zucker und weiteren, ihr unbekannten Ingredienzen, die nur möglicherweise irdischen Ursprungs sind, durch den Konsum mehrerer Liter destillierten Wassers neutralisiert zu haben.
Man bekommt also alles, was das Herz begehrt, vorausgesetzt, es begehrt Zucker.
Bemerkenswert allerdings ist die landesübliche Praxis beim Erwerb größerer Einrichtungsgegenstände, welche geliefert werden müssen. Der größte Teil des Verkaufsgesprächs handelt zum Erstaunen des Europäers von etwas vollkommen anderem als dem eigentlichen Produkt und dessen ausgezeichneter Qualität. Im ignoranten Leser keimt selbstverständlich nun die Vorstellung von geschickt geführten Preisverhandlungen, wie sie von Basaren im nahen und fernen Osten bekannt sind. Wieder einmal muss der Laie belehrt werden: Costa Rica ist eine fortschrittliche stabile Demokratie mit gut organisierter Marktwirtschaft, intaktem Schulwesen und durchdachtem Gesundheitswesen, in der selbstverständlich Festpreise üblich sind – die für Einheimische und die für Gringos.
Das Gespräch dreht sich in seinem Hauptteil um die Lieferadresse. Das Problematische daran ist nämlich, dass es eine solche eigentlich nicht gibt. Die Administration kann sich nicht entschließen, die in weiten Teilen der Erde erprobte und bewährte Praxis von Straßennamen und Hausnummern umzusetzen und erfreut die Einwohner mit der Notwendigkeit des Austausches mehr oder weniger umfangreicher Wegbeschreibungen, welche sich meist an einem größeren öffentlichen Gebäude orientieren und dann mit der Angabe von Entfernungen, Himmelsrichtungen, Breiten-und Längengraden fortgeführt werden. Der Käufer erläutert also wortreich, wo sich sein Domizil befindet, und sein Gegenüber plagt sich erfolgreich damit, diese Ausführungen in dem Teil des Formulars für das Zustandekommen des Verkaufsgeschäfts unterzubringen, in dem die Adresse vorgesehen ist. Diese Formulare sind dem soeben geschilderten Vorgang bedauerlicherweise nicht angepasst, sondern bieten nur ausreichenden Platz für die Eintragung eines Straßennamens und einer Hausnummer. Die Verwaltung ist da der Praxis weit voraus…
Kommen sich die Parteien im Verlauf der Unterhaltung näher, so wird auch gerne Persönliches – die Familie betreffend – ausgetauscht („Ist das in der Nähe von…? Da hat mal eine Tante mütterlicherseits gewohnt.“) Reichlich Platz ist im Formular vorhanden für die Angabe verschiedener Telefonnummern, was von großer Bedeutung ist, wenn der Lieferant schließlich mit der Ware unterwegs ist. Er ignoriert die sorgsam mitgeschriebene Wegbeschreibung des Kollegen nämlich konsequent und fährt ins Zentrum des angegebenen Ortes. Dort hält er an einem verkehrstechnisch wichtigen Ort an, sucht in seinen Unterlagen und ruft den Adressaten an, um den genauen Bestimmungsort zu erfragen. Der Käufer gibt die Wegbeschreibung an, die sich bereits auf dem Formular befindet, es folgt freundliches gegenseitiges Bedanken und Verabschieden. Einige Minuten später kann man die bestellte Ware an der Haustür in Empfang nehmen. Beim gemeinsamen Transport der Ware ins Haus werden üblicherweise Höflichkeiten ausgetauscht – die Familie betreffend („Es ist sehr schön und ruhig hier bei Ihnen. Eine Tante mütterlicherseits eines Kollegen hat mal hier in der Nähe gewohnt.“).
Während des Wartens keimen im Kunden verschiedene schreckliche Ideen auf, die diesen für europäische Gehirne schwer verständlichen Ablauf erklären könnten. (Eine Auswahl: Die Geschäfte hierzulande entbehren der in der Zivilisation üblichen Verbindlichkeit. – Der Fahrer ist ein Hinterweltler, der das Formular nicht mitgeführt hat oder nicht lesen kann. – Es ist Gefahr in Verzug, weil Belege fehlen, Quittungen fehlerhaft ausgestellt werden, Betrug, Raub und Mord beabsichtigt sind.) Diese Überlegungen brechen ab, wenn die Beträge auf der vorschriftsmäßig ausgehändigten Quittung korrekt sind und die Plauderei auf Englisch fortgeführt wird, weil des Käufers Spanischkenntnisse zum wiederholten Male nicht ausreichen.
Auf den erhaltenen Belegen kann man übrigens auch noch mal die Wegbeschreibung nachlesen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.