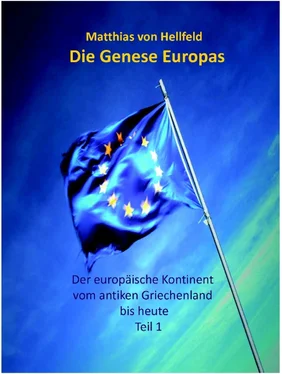480 v. Chr. wird das Jahr der Entscheidung und die soll in einer Seeschlacht fallen, zu der Themistokles die Athener Strategen überredet hat. Wie Recht er mit der Einschätzung hat, dass das riesige persische Heer in einer offenen Feldschlacht nicht zu besiegen sei, hatte sich ja an den Thermophylen erwiesen. Dort ist es nur zwei Tage gelungen, die Perser aufzuhalten. Danach ist die persische Übermacht durchgebrochen und in ein Land vorgestoßen, das von den Griechen weitgehend geräumt ist. Viele Menschen sind in wilder Panik aus ihren Dörfern gestürmt und haben ihr Heil in der Flucht gesucht. Xerxes I. aber kennt nur ein Ziel: Athen. Ist erst die mächtigste Stadt vernichtet, wird auch der Widerstandswille seiner überlebenden Bewohner gebrochen sein. In Athen angekommen, besetzt und verwüstet er die weitgehend verlassene Stadt – trotzdem: Es soll eine Warnung für all jene sein, die sich der persischen Herrschaft widersetzen würden. Währenddessen haben sich die Griechen auf die entscheidende Seeschlacht in der Meerenge vor der Insel Salamis westlich von Athen vorbereitet. Dies ist ihre letzte Chance. Würden sie diese Schlacht verlieren – das wissen sie – ist das Ende des freien Griechenlands besiegelt. Nach zwölf Stunden ist die Seeschlacht von Salamis mit einem Sieg der Griechen beendet. Der Verlauf der Schlacht ist nicht genau rekonstruierbar. Offenbar haben die Griechen mit kleinen und in der Bucht besser manövrierbaren Booten die großen persischen Schiffe wieder und wieder gerammt, bis sie gesunken sind. Der Siegeszug des persischen Königs Xerxes I. ist jedenfalls im Jahr 480 v. Chr. gestoppt.
Im Anschluss an diesen nicht erwarteten Sieg der Griechen werden die persischen Truppen in einige Folgekämpfe verwickelt, bis 478 v. Chr. die persische Vorherrschaft an der kleinasiatischen Küste gegenüber von Griechenland schließlich beendet ist. Ein Jahr später wird der attisch-delischen Seebund gegründet, mit dem Athen zur Hegemonialmacht Griechenlands aufsteigt. Mit diesem Bündnis sind sämtliche Küstenregionen des ägäischen Meeres bis hoch zum Bosporus in einem antipersischen Bündnis. Aber gleichzeitig birgt diese Allianz auch den Nagel zum eigenen Sarg, denn mit dem attisch-delischen Seebund entsteht der so genannte „Dualismus“ in Griechenland zwischen Athen und Sparta, der wenig später in einen blutigen Bruderkampf münden wird. 449 v. Chr. schließen Griechen und Perser den Kalliasfrieden. Auf Athener Seite verhandelt der Diplomat Kallias (500 – 432 v. Chr.) auf Seiten der Perser König Artaxerxes I. (ca. 500 – 424 v. Chr.). Wenn den Quellen getraut werden kann, was einige Historiker bezweifeln, dann haben sich beide Seiten auf eine Autonomie für die griechischen Städte und Enklaven an der kleinasiatischen Küste geeinigt. Persische Truppen dürfen sich außerdem nur in einer bestimmten Entfernung von diesen Orten aufhalten, was durch regelrechte Sperrzonen für persische Schiffe in der Ägäis gewährleistet werden soll. Als Gegenleistung verpflichtet sich Athen das Perserreich zu respektieren.
In den Augen der Griechen ist das drohende Schicksal der Versklavung in Persien abgewendet und der Despotismus, der den Persern unterstellt worden ist, vom griechischen Festland ferngehalten. Aber es gibt auch eine welthistorische Perspektive, die für den Fortgang der Geschichte von Bedeutung ist. Vermutlich stellt der griechische Abwehrkampf gegen die persischen Invasoren – wie nur wenige andere Daten in der Weltgeschichte – eine Wegmarke dar. Erst durch den Sieg der Griechen hat sich Europa zu dem entwickeln können, was es heute ist. Bei einer Niederlage hätte es für Xerxes I. und seine Nachfolger keine Barrieren mehr gegeben: Sie hätten ihr Reich immer weiter nach Westen – also nach Kontinentaleuropa – ausdehnen können. Dabei wäre – aller Voraussicht nach – die griechische Kultur verschüttet worden, die erst das römische Reich und später die mittelalterlichen und neuzeitlichen europäischen Staaten maßgeblich beeinflusst hat. Vielleicht wäre es auch nicht zum Imperium Romanum gekommen, das rund drei Jahrhunderte später eine neue Zivilisation im südlichen und westlichen Europa aufbauen sollte. Möglicherweise hieße Europa heute „Westasien“, deren Bewohner vielleicht Muslime oder jedenfalls nicht unbedingt Christen wären. Es ist vielleicht nicht zu weit hergeholt, wenn man sagt, dass die griechischen Kämpfer von Marathon oder Salamis knapp fünfhundert Jahre vor Christi Geburt die „Voraussetzungen“ dafür geschaffen haben, dass die Menschen des Abendlandes ihre geistige Unabhängigkeit und Freiheit erhalten haben – so lautet etwas verknappt der Gedanke von Herrmann Bengtson.
„Europa“ in der griechischen Antike
Während sich auf den Schlachtfeldern das Schicksal Griechenlands entschieden hat, sucht die Geschichtsschreibung jener Jahre der Auseinandersetzung mit den Persern einen Sinn oder einen Mythos zu geben. Der für die Perserkriege wichtigste antike Chronist ist Herodot (480 – 425 v. Chr.). Er gilt als einer der Urväter der griechischen Geschichtsschreibung. Bis weit ins Mittelalter hinein hat er das Wissen der Menschen über die Antike geprägt. Herodot hat den griechischen Freiheitskampf überliefert, von ihm stammen die meisten Informationen, mit denen die Geschichtsschreibung jedoch äußerst vorsichtig umgeht. Dennoch spiegelt sein Werk das Denken und die Ideologie jener Jahre. Europa, so hat er geschrieben, sei so lang wie Libyen und Asien zusammen. Man wisse nicht, ob Europa von Meeren umgeben sei und wer dem Kontinent den Namen gegeben habe. Vermutlich gehe der Name auf „Europa von Tyros“ zurück, die von Phönizien nach Kreta gekommen sei. Die Überlieferung des Namens „Europa“, der sich Herodot in Ermangelung einer Alternative angeschlossen hat, geht auf eine Sage zurück, die Hesiod überliefert hat. Danach ist die phönizische Prinzessin „Europa von Tyros“ durch den zum Stier verwandelten Göttervater Zeus von Tyros – im heutigen Libanon - nach Kreta entführt worden. Dort habe sie bei der Namensgebung des Kontinents Patin gestanden. Dieses folgenschwere Ereignis soll sich in der Bronzezeit rund 7.000 Jahre vor der Geburt Christi zugetragen haben. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Name Europa aus dem phönizischen Begriff „erebu“ für das „Land im Westen“, wo die Sonne untergeht, herleitet.
Herodot hat sich sehr intensiv den ideologischen Gründen für den Krieg mit den Persern, deren Augen- und Zeitzeuge er gewesen ist, gewidmet. Bei ihm wird Europa zum politischen Kampfbegriff, denn er hat die Ursache der Kriege in der Auseinandersetzung zwischen „Freiheit und Demokratie“ auf der einen und „Despotismus“ auf der anderen Seite gesehen. Freiheit und Demokratie sind für Herodot identisch mit Europa, Despotismus charakterisiert Asien. Um seine Behauptung zu belegen, führt er an, in Athen müsse sich jeder Machthaber kontrollieren lassen, was nach den verschiedenen Verfassungsreformen zumindest nicht völlig falsch ist. In Persien hingegen würden die Despoten von niemandem kontrolliert. Zum ersten Mal wird durch Herodot die damals bekannte Erde in zwei sich diametral gegenüberstehende Hälften geteilt: Asien und Europa. Und Herodot bildet obendrein das ideologische Gegensatzpaar: Freiheit gegen Knechtschaft!
Herodot markiert in seinen Texten neben der politischen auch eine kulturelle Trennlinie zwischen Europa, das für ihn hauptsächlich Griechenland gewesen ist, und Asien, am gegenüberliegenden Ufer der Ägäis. Mit dieser Deutung hat er ein „Urteil“ in die Welt gesetzt, das aus der Sicht der Zeitgenossen vielleicht nachvollziehbar gewesen ist. Für Herodot hat der persische König nämlich die griechische Lebensweise angegriffen, die Errungenschaften der Demokratie in Frage gestellt und nach der Macht auf dem europäischen Kontinent gegriffen. Die Verteidigung der Griechen gegen die Perser ist damit vielmehr als „nur“ ein Krieg wie jeder andere gewesen. Bei Herodot ist es auch ein Krieg der Systeme, die Auseinandersetzung der Kulturen und der Kampf ums Überleben Griechenlands und damit auch Europas gewesen. Herodot stempelt mit seiner Deutung indirekt das persische Volk ab, er negiert ihre kulturellen Leistungen und den großen Mut, mit dem sich die Kämpfer in unbedingter Treue für den persischen König geschlagen haben. Insofern also ist Herodots Urteil ziemlich einseitig, aber es spiegelt die Meinung seiner Zeit wider. Sein Urteil ist in der Welt geblieben und wird - zum Vorurteil mutiert - immer wieder gegen „asiatische Horden“, „Hunnen“ oder „Steppenbewohner“ angewendet. Herodot hat damit etwas vorgegeben, was bei der Identitätsfindung der Europäer noch sehr oft zu beobachten sein wird: Identität entsteht durch die Negierung von etwas anderem. Auch bei Herodot entwickelt sich die Identifikation mit Demokratie und Freiheit durch die Gegenüberstellung mit dem despotischen Gegenteil. Ohne die Kriege gegen die Perser hätte es diesen Selbstfindungsprozess im antiken Griechenland vielleicht nicht gegeben. Jedenfalls ist die erfolgreiche Verteidigung ihrer griechischen Heimat zum europäischen Mythos geworden ist.
Читать дальше